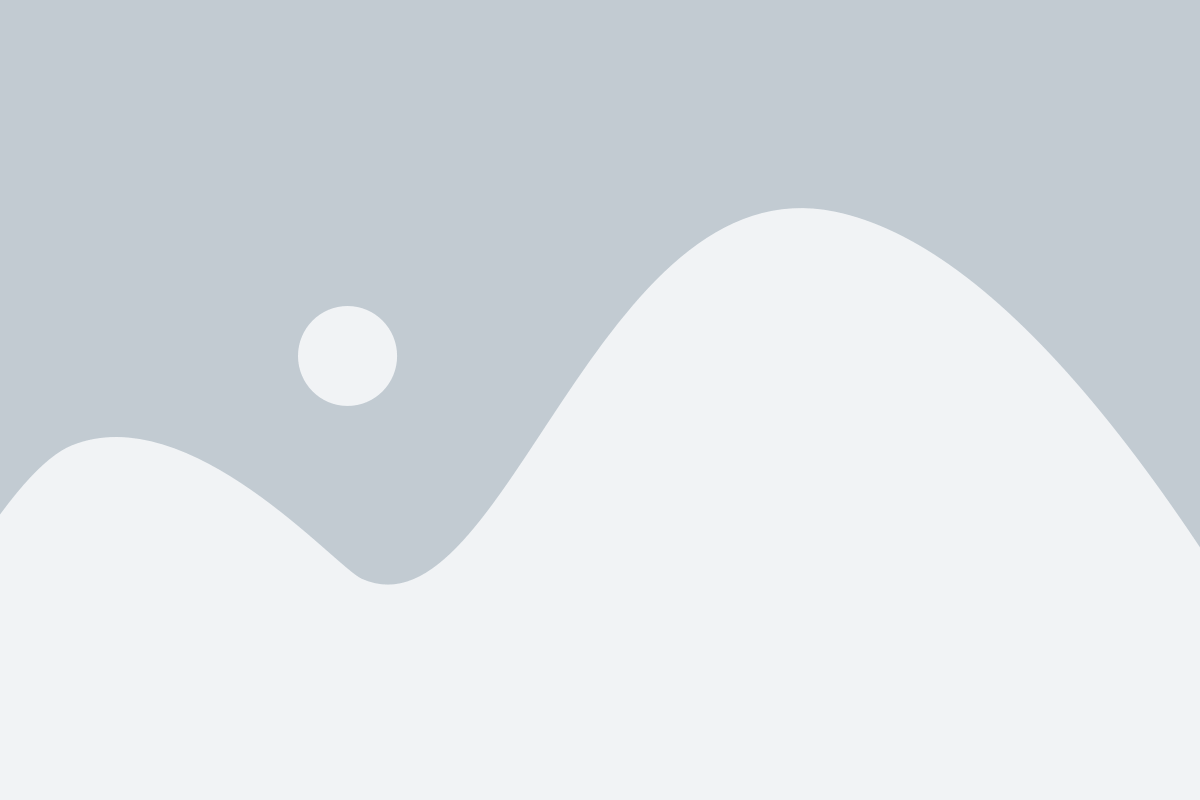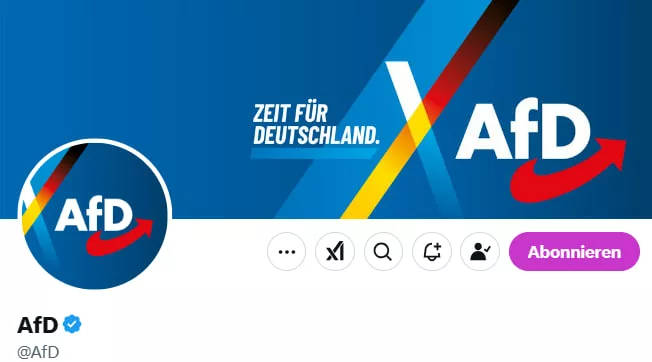Die AfD hat beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe erfolglos gegen die Nichtvergabe von Ausschussvorsitzen an ihre Bundestagsabgeordneten geklagt. Die zentrale Frage dabei war, ob die AfD ein verfassungsrechtlich garantiertes Anrecht auf den Vorsitz bestimmter Ausschüsse im Bundestag hat. Das Gericht urteilte, dass die Rechte der AfD-Fraktion nicht verletzt wurden, obwohl keiner ihrer Abgeordneten den Vorsitz eines Ausschusses innehat. Auch die Klage des AfD-Abgeordneten Stephan Brandner, der zuvor als Vorsitzender des Rechtsausschusses abgewählt worden war, wurde abgelehnt.
„Eine Verletzung des Rechts der Antragstellerin auf Gleichbehandlung als Fraktion aus Art. 38 Abs. 1 Satz 2 Grundgesetz (GG) in Verbindung mit dem Grundsatz der fairen und loyalen Auslegung und Anwendung der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages (GO-BT) liegt nicht vor. Die Antragstellerin kann sich zwar auf das Recht auf Gleichbehandlung bei der Besetzung der Ausschussvorsitze stützen. Die Durchführung von Wahlen zur Bestimmung der Ausschussvorsitze und die Abwahl vom Vorsitz des Rechtsausschusses bewegen sich jedoch im Rahmen der dem Bundestag zustehenden Geschäftsordnungsautonomie (Art. 40 Abs. 1 Satz 2 GG).“
Bundesverfassungsgericht / Pressemitteilung
Ausschussvorsitze im Bundestag: Verfassungsrechtliche Grundlagen
Die Ausschüsse des Deutschen Bundestages spielen eine zentrale Rolle in der parlamentarischen Arbeit. Sie bereiten Entscheidungen vor, erarbeiten Gesetzesvorlagen und sind in besonderer Weise dafür verantwortlich, Themen detailliert zu erörtern. Die Geschäftsordnung des Bundestages legt fest, dass die Zusammensetzung der Ausschüsse die parteipolitischen Mehrheitsverhältnisse im Plenum widerspiegeln muss. Diese Regelung sorgt dafür, dass alle Fraktionen entsprechend ihrer Stärke in den Ausschüssen vertreten sind. Dies gilt jedoch nicht zwingend für die Vergabe der Vorsitzposten, wie der Fall der AfD zeigt.
Gemäß § 12 der Geschäftsordnung soll die Vergabe der Vorsitzendenpositionen nach dem Verhältnis der Fraktionsstärke erfolgen. Gleichzeitig regelt § 58 der Geschäftsordnung, dass die Ausschüsse selbst ihre Vorsitzenden wählen dürfen. Dies führte dazu, dass die AfD bisher keine Mehrheit für einen ihrer Kandidaten erhalten konnte, obwohl ihr dementsprechend drei Vorsitzposten zustünden.
Die rechtliche Herausforderung: Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts
Die AfD sieht in der wiederholten Nichtwahl ihrer Abgeordneten für den Vorsitz der Ausschüsse eine Verletzung ihrer parlamentarischen Rechte. Die Partei argumentierte, dass ihr nach der Geschäftsordnung proportional zur Fraktionsstärke auch Vorsitzende in den Ausschüssen zustehen. Das Bundesverfassungsgericht stellte jedoch fest, dass die Geschäftsordnung den Ausschüssen erlaubt, die Vorsitzenden frei zu wählen. Somit sei die Nichtwahl der AfD-Kandidaten rechtmäßig, solange keine systematische Benachteiligung vorliegt. Es bestehe kein verfassungsrechtlicher Anspruch der AfD, dass ihre Abgeordneten in solche Positionen gewählt werden müssen.
Die Klage der AfD stellt das Gericht vor komplexe verfassungsrechtliche Herausforderungen. Es gilt, einen Ausgleich zwischen der freien Wahl der Ausschussvorsitzenden und der Frage zu finden, ob jede Fraktion gemäß ihrer Stärke im Bundestag bei der Vergabe dieser Posten berücksichtigt werden muss. Die Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts, Doris König, sprach im Vorfeld von einem „verfassungsrechtlichen Spannungsverhältnis, das nur schwer aufzulösen sei.“
Historischer Kontext und Bedeutung des Verfahrens
Vor dem Einzug der AfD in den Bundestag im Jahr 2017 war es üblich, dass die Vorsitzenden der Ausschüsse nach interfraktionellen Absprachen per Akklamation gewählt wurden. Mit dem Einzug der AfD änderte sich dies. Seitdem werden die Vorsitzenden per geheimer Abstimmung gewählt, was dazu führte, dass Kandidaten der AfD regelmäßig keine Mehrheit erhielten. Dieses Verfahren wurde bereits in den 1960er Jahren im Bundestag angewendet, jedoch selten.
„Zu Beginn der 20. Wahlperiode kam das Zugriffsverfahren bei der Verteilung der Ausschussvorsitze zur Anwendung. […] In den konstituierenden Ausschusssitzungen am 15. Dezember 2021 wurden auf Antrag der Regierungsfraktionen geheime Wahlen zur Bestimmung der Vorsitzenden durchgeführt. Bei diesen Wahlen erhielt keiner der von der Antragstellerin vorgeschlagenen Kandidaten die erforderliche Mehrheit.“
Bundesverfassungsgericht / Pressemitteilung
Die AfD sieht in der Ablehnung ihrer Kandidaten eine gezielte Benachteiligung durch die anderen Fraktionen, insbesondere durch SPD, Grüne, FDP und Union. Diese wiederum argumentieren, dass ein Ausschussvorsitzender eine besondere Verantwortung trage und sich von der oft radikalen Parteirhetorik distanzieren müsse. Dies sei bei den Kandidaten der AfD jedoch nicht der Fall gewesen, weshalb es an dem notwendigen Vertrauen fehle.
Stephan Brandners Abwahl
Der Fall des AfD-Abgeordneten Stephan Brandner, der im Jahr 2019 als Vorsitzender des Rechtsausschusses abgewählt wurde, war von besonderer Bedeutung. Brandner wurde als erster Vorsitzender eines Bundestagsausschusses in der Geschichte der Bundesrepublik von seinem Amt enthoben. Der Auslöser war seine umstrittene Äußerung, bei der er das Bundesverdienstkreuz für den Musiker Udo Lindenberg als „Judaslohn“ bezeichnete und nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle von Politikern sprach, die vor Synagogen „rumlungerten“. Diese Äußerungen wurden von vielen Abgeordneten als antisemitisch und unangemessen wahrgenommen, weshalb eine Mehrheit im Rechtsausschuss für seine Abwahl stimmte. Johannes Fechner von der SPD charakterisierte Brandners Auftritte zu jener Zeit folgendermaßen:
„Er hat zum einen statt dem Gebot der Mäßigung entsprechend und auf Kompromisse hin zu wirken, seine Aufgaben als Ausschussvorsitzender missbraucht – für Parteipolitik und für rechte Hetze. Das hat dazu geführt, dass wichtige Verbände in der Rechtspolitik sich abgewandt haben, und deswegen haben wir die Notbremse ziehen müssen, und haben die Abwahl durchgeführt.“
Johannes Fechner / Tagesschau
Brandner argumentierte, dass seine Abwahl unrechtmäßig sei, da die Geschäftsordnung des Bundestages keine Abberufung eines Ausschussvorsitzenden vorsehe. Das Bundesverfassungsgericht entschied jedoch, dass die Abwahl verfassungsgemäß war, da das Vertrauen in Brandner seitens der anderen Abgeordneten des Rechtsausschusses erheblich beschädigt wurde.
Verfassungsrechtliche Implikationen und Ausblick
Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat große Auswirkungen auf die Vergabe der Ausschussvorsitze im Bundestag. Ein Problem ist, dass das aktuelle System es der Mehrheit im Bundestag ermöglicht, die Postenvergabe zu kontrollieren, wodurch die Opposition benachteiligt werden kann. Rechtsexperten wie Sven Hölscheidt schlagen vor, dass die Ablehnung eines Kandidaten künftig erklärt werden muss, um Diskriminierung zu verhindern. Dieser Vorschlag könnte dazu beitragen, sowohl die freie Wahl der Ausschussvorsitzenden als auch die proportionalen Ansprüche der Fraktionen zu berücksichtigen.
Das endgültige Urteil des Bundesverfassungsgerichts steht noch aus. Es wird sich zeigen, ob das Gericht eine neue Regelung für die Vergabe der Ausschussvorsitze einführt oder ob die bisherige Praxis bestehen bleibt. Die zentrale Frage, ob die AfD ein verfassungsmäßiges Recht auf den Vorsitz in Ausschüssen hat, wurde vom Bundesverfassungsgericht verneint. Der Fall Brandner verdeutlicht, dass der Umgang mit Ausschussvorsitzenden oft mehr mit politischem Interesse als mit objektiven Kriterien zu tun hat. Die Auseinandersetzung zeigt, wie problematisch es ist, wenn Entscheidungsprozesse bei der Vergabe von Ausschussvorsitzen nicht transparent sind.
Es bleibt unklar, ob das Bundesverfassungsgericht in seinen bisherigen Entscheidungen die Interessen der Opposition ausreichend berücksichtigt hat oder ob es unbeabsichtigt zur politischen Marginalisierung beiträgt. Stephan Harbarth, der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, sieht sich aufgrund seiner umstrittenen Vergangenheit einem Vertrauensdefizit gegenüber. Neben der Frage seiner Unabhängigkeit steht auch das grundsätzliche Prinzip zur Diskussion, ob der Wechsel von Politikern und Anwälten, die als Interessenvertreter bekannt sind, in ein hohes Gericht wie das Bundesverfassungsgericht angemessen ist, da politische Vorlieben und Machtverhältnisse möglicherweise die Entscheidungsprozesse beeinflussen.