Ein persönlicher Kommentar aus der Praxis
Es fiel mir nicht leicht, diesen Artikel zu schreiben, da ich persönlich stark in das Thema der letzten Lanz-Sendung involviert bin und Aussagen wie die unserer Bildungsministerin Karin Prien „Können wir auch mal über Lösungen sprechen?“ mit wachsender Fassungslosigkeit verfolge.
Immerhin gelangen einige Probleme, die lange tabuisiert wurden, inzwischen in die öffentliche Debatte, doch das geschieht zu spät, nur oberflächlich, realitätsfern und selten lösungsorientiert.
Ich möchte in diesem Kommentar keine Grundsatzkritik an einzelnen Personen formulieren, sondern den Blick auf die Realität an deutschen Schulen lenken. Eine Realität, die für Lehrkräfte – insbesondere in Vollzeit – zunehmend untragbar geworden ist. Es geht hier nicht um individuelle Belastung, sondern um ein strukturelles Versagen, das Menschen systematisch überfordert.
Die Realität vieler Lehrkräfte
Katja Giesler, Lehrerin aus Hessen, berichtet am 26. Juni bei Lanz von einer Sammel-Überlastungsanzeige, an der sich über 40 Schulen beteiligt haben. Ihr Ziel ist, endlich öffentlich zu machen, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt, sondern um ein strukturelles Problem.
In solchen Anzeigen, die normalerweise nicht kollektiv erfolgen, werden Lehrern oft nur Maßnahmen wie Achtsamkeitstrainings oder Yogakurse angeboten, was symptomatisch ist für ein System, das die wahren Ursachen konsequent ignoriert.
Meine eigene Erfahrung bestätigt das. Unter den derzeitigen Bedingungen hält kaum jemand diesen Beruf in Vollzeit durch, ohne gesundheitlich auszubrennen. Lehrkräfte sollen heute nicht nur unterrichten, sondern zugleich Ganztagsangebote organisieren, Datenschutzfragen klären, Verwalten und dokumentieren, mit Psychologen, Jugendamt, Sozialarbeitern, Schulbegleitern, Eltern und Kindern kommunizieren, Kinder unterrichten, die teils kaum oder kein Deutsch sprechen, Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten betreuen – oft ohne entsprechende Ausbildung, womit Katja Giesler nur einige Beispiele herausstellt.
Fast jedes Kind ist inzwischen ein „Einzelfall“, sei es durch familiäre Belastungen, sprachliche Defizite oder soziale Verwahrlosung. Für Schüler mit stabiler Lernvoraussetzung bleibt kaum noch Zeit.
Ein System auf Dauerstress
Man leitet zum Beispiel eine fünfte Klasse, deren Schüler nahezu ihre gesamte Grundschulzeit unter Lockdowns der Maßnahmen-Krise verbracht haben. Das bedeutet, dass kaum Beschulung stattfand und entsprechend massive Lücken vorhanden sind. Lesen, Schreiben, grundlegende Kompetenzen befinden sich vielfach auf einem kaum vorstellbaren Niveau. Der Lehrplan aber setzt ganz andere Voraussetzungen voraus.
Fünftklässler bringen ohnehin eine Vielzahl an Umstellungsproblemen mit, in diesem Fall gepaart mit einer enormen emotionalen Unsicherheit. Viele wollen jedes Erlebnis, jeden Streit, jedes familiäre Problem sofort mitteilen. Gleichzeitig wechselt man alle 45 bis 90 Minuten in eine neue Klasse. In jeder strömen Kinder mit individuellen Problemen auf einen zu.
Während der Pausen eskalieren regelmäßig Konflikte, teils mit körperlicher Gewalt. Der Geräuschpegel ist enorm. Dennoch bleibt kaum Zeit, sich den Konflikten zu widmen, denn es müssen Klassenarbeiten vorbereitet, geschrieben und korrigiert werden, das meiste davon in der unterrichtsfreien Zeit, an Wochenenden oder in den Ferien.
Unterrichtet man Sprachen in Klassen, in denen ein Drittel der Kinder kaum schreiben kann, wird jede Korrektur zur Mammutaufgabe.
Die Pausen sind keine wirklichen Pausen. Es gibt selten das Lehrerraumprinzip, also tragen Lehrkräfte ihre Materialien ständig mit sich herum. Auf den Wegen sprechen einen Kinder an, die weinen oder streiten; Kollegen wollen organisatorische Fragen klären; das Sekretariat meldet, dass Eltern, Psychologen oder das Jugendamt zurückzurufen sind.
Gleichzeitig sinkt die Konzentrationsspanne bei vielen Schülern. Alle 15 Minuten muss man gegen den wiederkehrenden Lärm ankämpfen. Die Lärmbelastung ist gravierend und besonders deutlich, wenn man in der vermeintlich längeren Pause auch noch Aufsicht in der Mensa hat.
Am Nachmittag steht man dann beispielsweise einem Kind gegenüber, das in Tränen aufgelöst ist, weil es Ritalin nehmen muss, um überhaupt „funktionieren“ zu können. Solche Momente treffen mitten ins Herz, aber es fehlt die Energie, noch für ein Gespräch auf Augenhöhe da zu sein. Man möchte zuhören, ernst nehmen, helfen und ist längst leer.
Ganztag und permanente Anspannung
Der Ganztag ist an vielen Schulen längst Alltag. Doch was auf dem Papier als Förderung gedacht war, bedeutet in der Realität, keine Pause, keine Entlastung. Stattdessen Essen in der lauten Mensa während der Aufsicht oder im ebenfalls geschäftigen Lehrerzimmer bei Gesprächen über die Arbeit, keine Regeneration, und nachmittags die nächste Klasse. Mit Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Schwindel. Mit dem Gefühl; du kannst niemandem mehr gerecht werden.
Inklusion als zusätzliche Herausforderung
Zu alldem kommt die Inklusion; in einer Klasse mit 25 Schülern befinden sich mindestens ein bis zwei mit Handicap, aber keine ausreichende personelle oder fachliche Unterstützung. Die UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet Deutschland seit 2009 zur Umsetzung eines inklusiven Bildungssystems. In der Praxis aber ist Inklusion oft nichts weiter als eine zusätzliche Belastung und ein Etikett ohne Substanz.
Zahlen hinsichtlich der Überlastung von Lehrern belegen den desolaten Zustand. Dieses System macht krank. Es frustriert. Es entfremdet von dem Beruf, den viele mit Idealismus begonnen haben.
Blick in die Debatte – Markus Lanz, Juni 2025
Die Talkrunde bei Lanz zeigt einige dieser Missstände auf. Katja Giesler spricht von 80 % Migrationsanteil an ihrer Schule mit ebenso vielen Kindern, die dem Unterricht nicht folgen können. Ahmad Mansour verweist auf gesellschaftliche Veränderungen; Kinder, die ohne Deutschkenntnisse ankommen, Kinder, die mit dem Handy schlafen, kaum Empathie entwickeln, die Lehrerinnen beleidigen oder sie nicht anerkennen, weil sie Frauen sind.
Er schildert das Problem religiös motivierten Mobbings und eine deutsche Debattenkultur, die echte Probleme oft tabuisiert. Der Kindergartenbesuch solle verpflichtend werden, wenn Sprachtests nicht bestanden würden. Doch wie soll man Eltern Vertrauen in ein System abverlangen, das bei Schulkindern längst versagt hat. Welche Auswirkungen die Corona-Zeit auf die Kinder hat, wird selten ausreichend erfasst. Dass die Lockdowns an Schulen ein Fehler mit weitreichenden Folgen waren, leugnet kaum noch jemand, nicht einmal Karl Lauterbach. Rund 68 % der Eltern berichten von erheblichen Lernlücken bei ihren Kindern, von der Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit ganz zu schweigen. Mansour beurteilt es so, dass viele Kinder emotional nach den Lockdowns nicht zurück in der Schule angekommen sind.
Unwahrscheinlich, dass das Vertrauen danach durch noch mehr Schulpflicht wiederhergestellt werden kann.
Markus Lanz erwähnt eine Lehrerin, die nach Kanada auswanderte, weil sie psychisch am Ende war. Auch ich kenne viele Kollegen, die mittlerweile ausgestiegen sind und es werden mehr. Bild berichtet im Oktober letzten Jahres von 80 Prozent der Lehrer, die in Bayern wegen Dienstunfähigkeit durch Überforderung in den frühzeitigen Ruhestand gehen, zwanzig Jahre vorher waren es nur 39 Prozent.
Laut eines Artikels der Welt von 2022 schätzten in Nordrhein-Westfalen 85 Prozent der Lehrkräfte „ihre persönliche Arbeitsbelastung als stark oder sehr stark ein“, ein Wert, der noch leicht über dem ohnehin schon alarmierenden Bundesschnitt von 84 Prozent liegt. Etwa jede zweite Lehrkraft in Deutschland fühlt sich körperlich (62 Prozent) oder psychisch (46 Prozent) dauerhaft erschöpft.
Fazit: System am Limit – und darüber hinaus
Man arbeitet mit Kindern, die traumatisiert, überreizt oder komplett überfordert sind. Man kämpft gegen Lärm, Erwartungen, Bürokratie und auch gegen die eigene Erschöpfung.
Man versucht zu helfen, ohne helfen zu können.
Man ist da, aber oft selbst kaum noch präsent.
Am Ende steht die Frage, wie lange das noch gut gehen soll, denn dieses System verbraucht seine Menschen; Lehrkräfte wie Kinder und wer geht, kommt oft nicht zurück.
Hinweis: Dieser Text basiert auf persönlichen Erfahrungen, journalistischen Recherchen und öffentlich zugänglichen Quellen. Die geschilderten Beobachtungen spiegeln die Realität vieler Lehrkräfte wider – sie ersetzen keine offizielle Position und erfolgen im Rahmen des grundgesetzlich geschützten Rechts auf Meinungsäußerung (§ 5 GG).






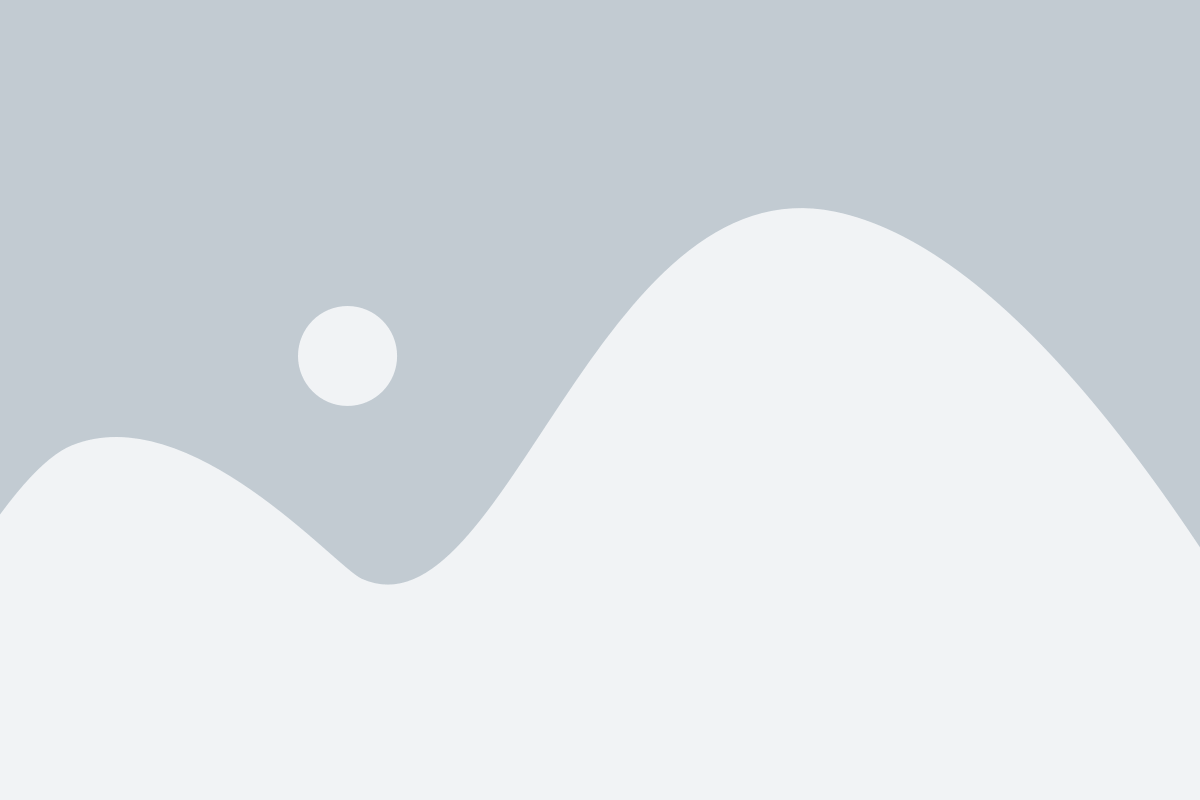







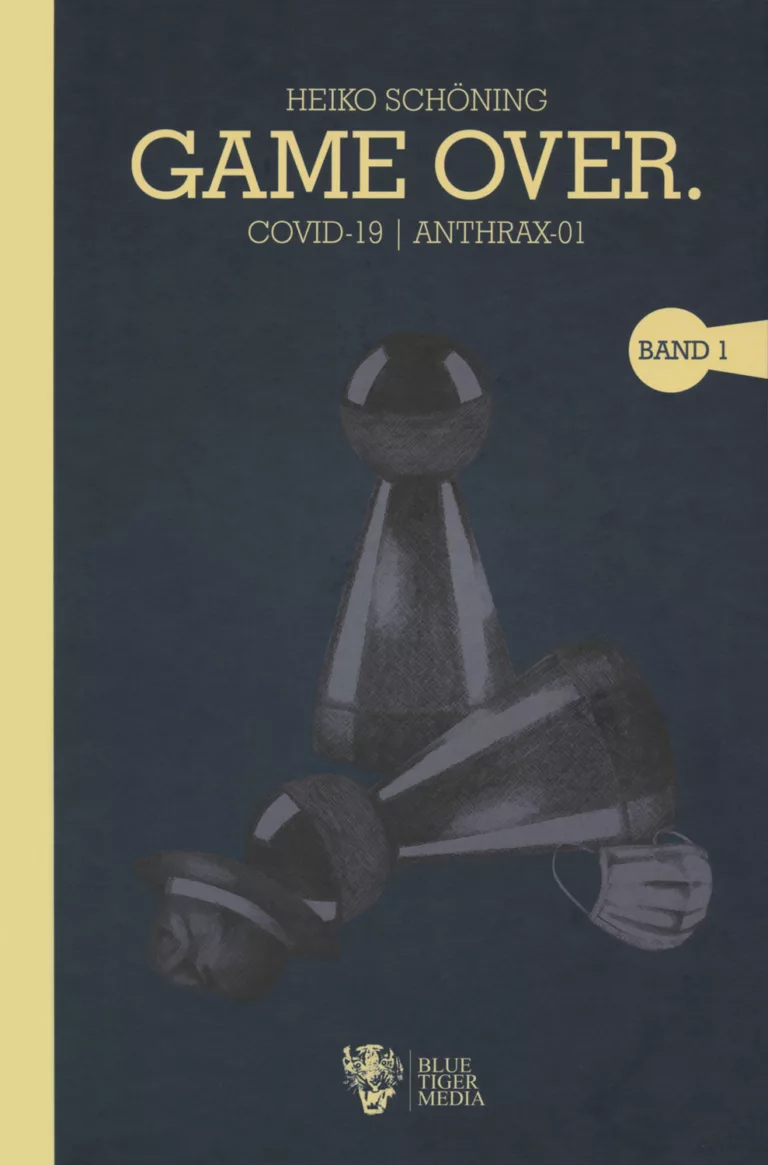




10 Antworten
Genau aus diesem Grund sollte man sich überlegen, ob man in diesem System Kinder in die Welt setzt, denn in diesem Land haben sie keine Perspektive mehr. Einziger Ausweg wäre eine Privatschule oder das Land ganz zu verlassen. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal soweit gehen würde. Diese politische Kaste, auch genannt Kartellparteien, haben dieses Land abgewirtschaftet und auf dem Gewissen. Danke für Nichts.
Frau Jörg,
zu „auf dem Gewissen.“
Nicht für Sie, sondern für die x Millionen Mittäter (MT) um uns herum:
Das Pack [1] in Nadelstreifen hat kein Gewissen.
Für alle:
MT sind die kleinkindhaften, aber hochgefährlichen Mitläufer-Zombies:
https://pbs.twimg.com/media/Gh-LtEgW0AAeer_.jpg
Sie — die Kastenmitglieder mit 20.000 bis 80.000 Euro leistungslosem Monatseinkommen — schicken ihre eigene Brut schon seit vielen Jahren auf Privatschulen.
Das Erste, was Bademeister und Rettungssanitäter lernen:
Selbstschutz kommt vor Fremdschutz. Wer mit dem ersten Absauf- oder Stromschlagopfer über den Jordan geht, der kann den anderen nicht mehr helfen. Auch nicht mehr der eigenen Familie.
Jeder, der das Land verlässt, so lange er/sie es sich noch finanziell leisten kann, hat meinen Respekt. Denn das ist kein einfacher, leichter Schritt.
Auch aus dem Ausland kann man Freie-Sachsen.info oder Die-Heimat.de unterstützen. Evtl. sogar besser.
[1] Was der Siggi darf, darf ich auch: Sueddeutsche.de/politik/ihr-forum-vizekanzler-zeigt-finger-darf-gabriel-das-1.3124307 / archive.md/2SYAj
Liebe Frau Hoberg!
Vielen Dank für den Einblick in Ihre Arbeit und dem Schulalltag.
Ich habe für Sie und Ihre Kollegen den höchsten Respekt, für die, die sich in der Coronazeit für den Schutz der Kinder gegen die unsäglichen Maßnahmen eingesetzt haben und sich möglichst für die Belange, der Sorgen und Problemen der Kinder annehmen. Es ist so traurig für die Kinder und für Sie als Lehrkräfte, dass in diesen schlimmen Strukturen, keinem gerecht werden kann.
Wo soll das nur hinführen? Und wie soll es gelöst werden? Ich habe keine Antworten.
Bin heilfroh, dass meine nun erwachsenen Kinder noch größtenteils gute Lehrer hatten.
Alles Gute und viel Kraft für Sie und Ihren Kollegen!
Liebe Frau Krämer,
vielen lieben Dank für Ihren wertschätzenden, emphatischen Kommentar und Ihre guten Wünsche!
Die Antworten finden wir vielleicht woanders. Indem wir etwas vorleben, das einen Gegenpol darstellt, wo wir uns wieder mit Respekt, Liebe und Verständnis begegnen, sowohl für uns selbst als auch für unsere Mitmenschen. Indem wir echt und authentisch sind und die Wunden aufarbeiten.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ebenfalls nur das Beste!
Annika Hoberg
Frau Hoberg,
das Problem beim Respekt ist die täglich zunehmende Relativität und Definitionsbandbreite.
Sehr homogene Gruppen (Gesellschaften / Völker) haben einen Wertekodex mit vielen, für fast alle Mitglieder selbstverständlichen Regeln.
Bei sehr fremdartig durchmischten Gruppen ist das Gegenteil der Fall.
Per Link ein Beispiel mit Regeln über die vor 40 Jahren niemand diskutieren musste und von denen heute in westdeutschen Großstädten so gut wie nichts mehr eingehalten wird:
Stuttgarter-Nachrichten.de/media.media.23914414-e01a-4c03-8649-a5cc70f85b3b.16x9_700.jpg
Die offizielle Position, auf die Sie (großen?) Wert legen, definiert die offizielle Expertin Prof. Dr. Naika Foroutan so: „das migrantische Gold“. Und:
„Etabliertenrechte [der schon länger hier lebenden Ureinwohner U — I. N.] prallen also auf Neuaushandlungen [mit den oder unter den Neubürgern / Siedlern S, die eine extrem stärkere und mächtigere Lobby haben als U — I. N. ] …“
„Die Zeit ist reif für eine Kommission … neues Leitbild …“
https://www.focus.de/politik/meinung/gastbeitrag-von-naika-foroutan-sie-erkennen-ihr-land-nicht-mehr-dann-haben-sie-etwas-falsch-verstanden_id_203146719.html
Auf den Punkt gebracht: N. F. will eine von ihrer Gruppe, der Gruppe der Einwanderer, dominierte Kommission, die Respekt neu definiert.
Können Sie dazu bitte echt und authentisch — also ungeschminkt, ohne Selbstzensurschere im Kopf — öffentlich Ihre Meinung schreiben oder müssten Sie dann schmerzhafte Nachteile befürchten, die Sie nicht riskieren möchten?
Man darf aber nicht vergessen, dass ein Großteil der Lehrer die ‚bunte Vielfalt‘ nicht nur tatkräftig mit herbeigeführt hat, sondern auch erbarmungslos auf diejenigen eingedroschen hat, die von Anbeginn an auf Probleme hinwiesen.
Jetzt, wo die Situation in vielen Bereichen unbeherrschbar geworden ist, wird gejammert, man suhlt sich in Selbstmitleid und zieht sich unter voller Besoldung in den Krankenstand zurück. Oder gleich in die Frührente.
Die wahren Leidtragenden, nämlich die Kinder, lässt man kaltschnäuzig in der versalzenen Suppe sitzen.
Vielleicht sollten wir langsam mal von Pauschalurteilen Abstand nehmen. Es wird hier nichts vergessen, selbstverständlich auch nicht die Kinder. Der Schwerpunkt des Artikels liegt hier nun einmal auf der Perspektive der Lehrer, bzw. meinen individuellen Erfahrungen und Einschätzungen. Sie können sich denken, dass ich nicht zu denjenigen gehöre, die Sie eingangs beschreiben. Allerdings gibt es auch insgesamt im Verhalten der Kollegen kein reines Schwarz/Weiß. Ich darf mir an dieser Stelle erlauben, zu bemerken, wie viele der Kommentare seitens der „Widerstands-Bubble“ mittlerweile nur noch von Frust, Aggressivität und Feindbildern geprägt sind. Es gab mal Werte, die sich auf eine „Menschheitsfamilie“ bezogen. Ich empfehle an dieser Stelle auch meinen Artikel „Die Abwärtsspirale aus Krise, Frust und Resonanz“.
Herzliche Grüße und danke für Ihren Kommentar
Annika Hoberg
Frau Hoberg,
der Frust der Menschen, die teilweise seit 80 — achtzig Jahren — mit erhobenem Zeigefinger durch die Gegend laufen und dafür teilweise schon vor Ihrer Geburt „im besten Deutschland aller Zeiten“ Haftstrafen absitzen mussten, resultiert auch aus der Masse der Empörungsjournalisten (echter Widerstand?), welche die Leser täglich mit folgender Frage im Regen stehen lassen:
Und jetzt? Wie weiter? Was machen wir sogenannten Mitmenschen jetzt damit in der sogenannten Widerstands- und Solidargemeinschaft? Wie soll ich ab morgen mein tägliches TUN, meine Alltagsstruktur so ändern, dass ein systemrelevanter Machtwechsel für eine asymptomatische, also demokratisch radikale Kurskorrektur möglich wird?
Ein philosophisch-esoterisch andeutendes „Wunden aufarbeiten (lecken) und wieder mit Respekt, Liebe und Verständnis begegnen“ ist keine ausreichende Antwort.
Tipp vom Besserwisser Neitzke:
https://freiheit-beginnt-mit-nein.de/ueber-fbmn/
Damit kann man auch viele derer zu einem konkreteren Tun motivieren, denen bei Hinweisen auf Freie-Sachsen oder Die-Heimat sofort der kalte Angstschweiß ausbricht, weil sie glauben, daß ihnen dann vom SEK die Tür eingetreten wird.
Sie haben heute in Ihrem Lieblingsartikel einen Kommentar bekommen:
https://haintz.media/artikel/deutschland/die-abwaertsspirale-aus-krise-frust-und-resonanz/#comment-2255
Danke für den späten, aber noch nicht zu späten Hinweis auf Ihren Artikel zur Negativspirale. Er bestätigt meine Diagnose „esoterisch“ und lässt sich wie folgt zusammenfassen:
Lasst uns das Böse einfach weglächeln.
Zum Prinzip der Menschheitsfamilie habe ich mir die letzten 10 Minuten der 50:42 von Daniele Ganser angehört. Er spricht dort über einen Teil seiner Werte, aber nicht über eine Menschheitsfamilienlösung, die ja auch Sie ganz energisch und energetisch suchen oder schon gefunden haben und nun fordern mit
Aber so schnell und „schlampig“ gebe ich nicht auf zu erfühlen, was Sie konkret meinen könnten. Der Helmutkaess.de/moegliche-einfache-prinzipien/ schreibt:
„Wir haben nur die eine Erde,
die wir menschengemäß erhalten wollen.“
Nehmen Sie jetzt bitte aus dem Berg der Widersprüche und praxisreleventen Widerlegungen folgende zwei Splitterchen zur Kenntnis:
Tagesaktuell:
„Die Welt des offiziellen Experten Jens Spahn – Israel darf angreifen, weil so Schwule geschützt werden“
RTde.online/meinung/249522-welt-jens-spahn-israel-darf/
Dazu ein über den Tag hinausgehender, verstärkender, das globalistische Krankheitsbild manifestierender Zusatz vom
Martin mit dem roten Knopf und seinen Freunden. Siehe
Haintz.media/artikel/naher-osten/iran-zwischen-konflikt-und-perspektiven/
Sind Sie sich ganz sicher, dass es dieses Wir, diese Menschheitsfamilie tatsächlich gibt?
Falls ja, fühlen bzw. spüren Sie dieses Ja irgendwo im Gewebe Ihres Körpers?
Ja oder nein? Das ist eine sehr sachliche, ernste, klare, präzise, einfache und zumutbare Frage.
Tu ich Ihnen Unrecht mit „… weglächeln.“? Sind Sie noch auf der Suche nach Lösungen und suchen Sie positive Mitsuchende? Ja oder nein?
Mein Freundin Klara schmäht und verschmäht Sie mit dem hässlichen Wort Schwurblerin. Ich möchte der K. das freche Maul stopfen. Aber dazu brauche ich als Rationalist Ihre Argumentationsmithilfe. Haben Sie Lust mir zu helfen Ihre Reichweite und Ihr Spendengeldeinkommen zu steigern?
Ja oder nein?
Der Respekt den Sie fordern, beginnt mit Antwortanstand zu meiner Frage vom 1. Juli 2025, 23:01 Uhr:
Haintz.media/artikel/deutschland/systemueberlastung-schule-ein-erfahrungsbericht/#comment-2031
Alternativ dürfen Sie meine Definition zur Informations- und Meinungsfreiheit oder zum Wort Lüge in
https://haintz.media/artikel/deutschland/digitale-zensoren-wie-die-bundesnetzagentur-die-meinungsfreiheit-gefaehrdet/
widerlegen oder bestätigen oder zerlegen. Ist für Sie als Germanistin und Philosophin ein Klacks.
Ja, Frau Hoberg, wir sind in einer Abwärtsspirale.
Leider auch durch Menschen wie Sie. Zu wieviel Prozent fahrlässig oder vorsätzlich möchte ich hier nicht beleuchten. Das können Sie als Kennerin Ihres Kopfinhaltes am besten selbst.