Ein Beitrag von Kevin Eßer.
Zehn Monate nach seiner Amtseinführung hat Donald Trump Europa in eine Lage geführt, aus der es keinen eleganten Rückzug mehr gibt. Nicht durch Drohungen, nicht durch neue Kräfteverschiebungen, nicht einmal durch sichtbare Machtprojektion. Er setzte nur einen Schnitt, leise und präzise, zur perfekten Zeit, und traf damit den neuralgischen Punkt eines Systems, das sich über seine eigenen Ausnahmezustände definiert.
Als Brüssel und Kiew den Plan erstmals sahen, war der Handlungsspielraum bereits verglüht. Moskau signalisierte Zustimmung, Kiew spürte den Druck, und Europa begriff, wie gefährlich es wird, wenn ein außenstehender Akteur die eigene Mechanik besser versteht als man selbst.
Das war kein Zufall, sondern das Werk eines Mannes, der politische Dynamiken nicht beobachtet, sondern liest. Trump weiß, wo seine Macht endet und wo sie beginnt. Er kann keinen Stellvertreterkrieg gegen Russland finanzieren, und seine Wähler würden es ihm nie verzeihen. America First bedeutet, das nationale Interesse konsequent vom Rest der Welt zu entkoppeln: keine imperialen Abenteuer, keine weiteren Milliarden in fremden Verteidigungshaushalten, keine amerikanischen Soldaten in Konflikten, die nichts mit amerikanischer Sicherheit zu tun haben.
Doch der entscheidende Punkt liegt nicht in Washington oder Moskau. Er liegt in Europa selbst. Die Europäische Union hat ihre größte integrative Kraft in den Momenten entfaltet, in denen sie Krisen verwalten konnte. Der Ukrainekrieg beschleunigte die Union in einer Geschwindigkeit, die unter normalen Bedingungen unmöglich gewesen wäre: gemeinsame Verschuldung, militärische Kooperation, Energiezentralisierung, digitale Kontrollinfrastruktur, Postwachstumsprogramme.
Die EU definierte sich über die Dringlichkeit, nicht über den Konsens. Über die Ausnahme, nicht über das Normale.
Krieg als Legitimation für die EU
Der Krieg war dabei keine begleitende Variable, er war der tragende Pfeiler. Ohne ihn bröckelt der Vorwand für neue Armeen, neue Schuldenregime, neue Eingriffe in Wirtschaft und Gesellschaft, neue Machtbefugnisse für Kommission, Rat und angeschlossene Institutionen.
Ohne äußere Bedrohung fehlt die moralische Kulisse, hinter der Migration, Energiekrise und demografischer Niedergang verborgen wurden. Und ohne eine permanente Krise verliert ein systemisch technokratischer Apparat seine innere Legitimation.
Der Krieg in der Ukraine fungiert als permanentes Horroszenario und wird als Katalysator für die europäische Transformation gebraucht.

Entdecken Sie weitere Artikel von Haintz.media – direkt hier weiterlesen
________________________________________________________________________________
Genau hier setzt Trumps Schritt an. Er präsentiert einen Deal, den Moskau akzeptieren kann und den die Ukraine politisch kaum offen zurückweisen kann. Damit entzieht er der EU den Ausnahmezustand, auf dem ihr gesamter Transformationsprozess beruht. Denn sobald Frieden denkbar wird, verlieren alle weiteren Opfer ihren Schutzmantel. Jede weitere Milliarde, jeder Tote, jeder Winter erscheint nicht mehr als Verteidigung, sondern als politischer Selbstzweck, als Kosten eines Projekts, das ohne äußere Bedrohung sofort Selbstzweifel erzeugen würde.
Ein politisches System, das Frieden fürchtet, hat die Herrschaft über sich selbst bereits verloren. Mit seinem Schritt zwingt Trump Europa in eine binäre Entscheidung, die keine Flucht erlaubt: Nehmt den Frieden, oder tragt den Krieg allein. Mehr Optionen existieren nicht.
Europa kann nach Souveränität rufen, den Plan zurückweisen und sich entschlossen geben. Doch genau in diesem Moment verliert es den letzten amerikanischen Rückhalt. Kein Material mehr, keine logistische Unterstützung, keine haushaltspolitische Entlastung. Die Kriegskosten lägen binnen eines Jahres vollständig auf europäischen Schultern, dreistellige Milliardenbeträge, Jahr für Jahr. Unter dieser Last geraten selbst gefestigte Demokratien ins Wanken. Oppositionsparteien erreichen historische Höhen, Regierungen bröckeln, gesellschaftliche Spannungen eskalieren. Die EU würde nicht von außen zerdrückt, sondern von innen überdehnt.
Frieden als Möglichkeit
Oder Europa nimmt den Plan an und versucht, den Frieden als eigenen Erfolg zu verkaufen. Doch der Mythos wäre gebrochen. Wenn Frieden möglich ist, fällt die gesamte Erzählung der existenziellen Bedrohung in sich zusammen. Und mit ihr die Legitimation für jeden zentralen Pfeiler der europäischen Transformation: militärische Integration, drei Prozent des BIP für Rüstung, neue Schuldenpakete, Postwachstumsregime und Klimazentralismus, digitaler Euro als Steuerungsinstrument, Notstandsrechte und Krisennarrative. Ein Kontinent, der erkennt, dass er über Jahre künstlich in Alarmbereitschaft gehalten wurde, ist politisch nicht mehr formbar.
In beiden Szenarien gewinnt Trump, und er gewinnt auf zwei Ebenen gleichzeitig. Er gewinnt in Europa, weil er die Quelle der europäischen Integrationsenergie entzieht: die Dringlichkeit. Und er gewinnt in Washington, weil seine langjährigen Gegner entwaffnet sind. Die Neocons, Think-Tank-Falken und Interventionslobbyisten verlieren mit einem Schlag ihre moralische Grundlage. Ein Präsident, der Frieden anbietet und dessen Angebot von europäischen Partnern blockiert wird, kann innenpolitisch nicht mehr attackiert werden. Die alte außenpolitische Klasse verliert ihre Rechtfertigung, und damit ihre Macht.
Trump brauchte keine Truppen und keine Billionen. Er musste nicht einmal die amerikanische Außenpolitik neu ordnen. Er musste nur den Punkt treffen, an dem Europas politische Architektur am empfindlichsten ist: ihre Abhängigkeit vom Ausnahmezustand.
Er hat Europa nicht besiegt. Er hat nur den Raum beleuchtet, in dem Europa sich selbst verloren hat. Jetzt sieht jeder, worauf die europäische Ordnung in Wirklichkeit ruht und dass ein System, das nur im Krisenmodus stabil ist, den Frieden mehr fürchtet als den Konflikt. Und genau darin liegt sein vollendeter Triumph.
________________________________________________
Kevin Eßer ist ein deutscher Wirtschaftsliberaler und politisch aktiv. Er engagiert sich sowohl in der WerteUnion als auch in der Atlas-Initiative. In seinen Beiträgen möchte er komplexe Zusammenhänge aus freiheitlicher Perspektive überparteilich verständlich machen.

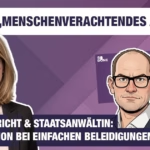









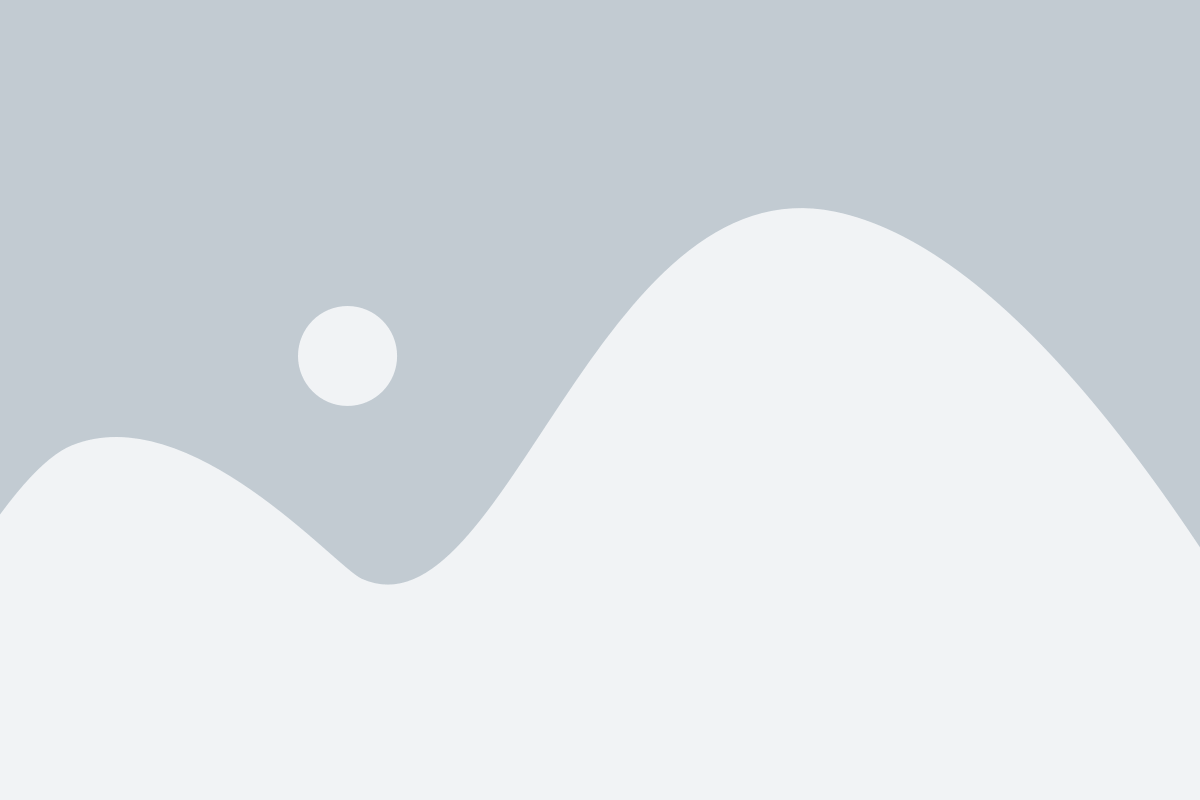

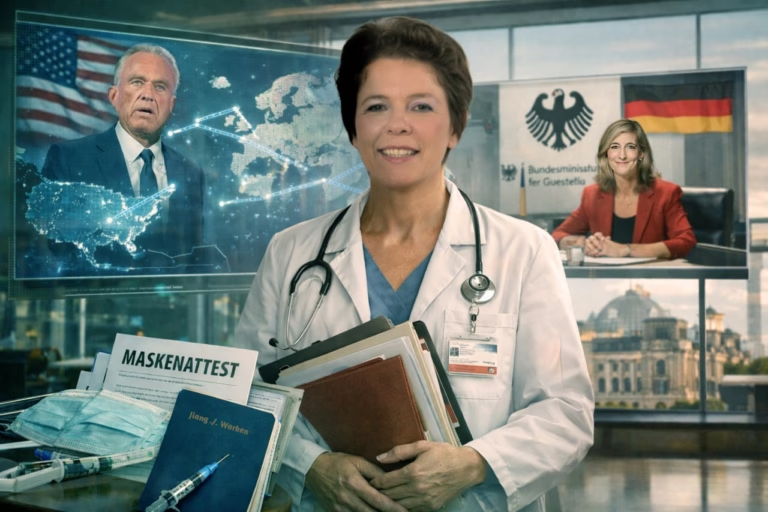

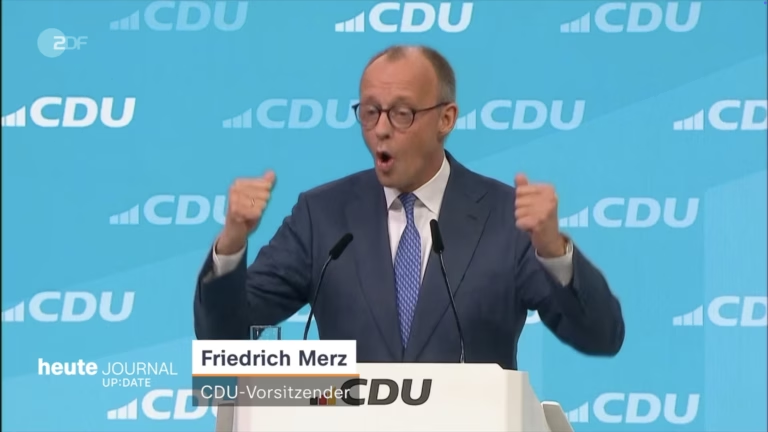



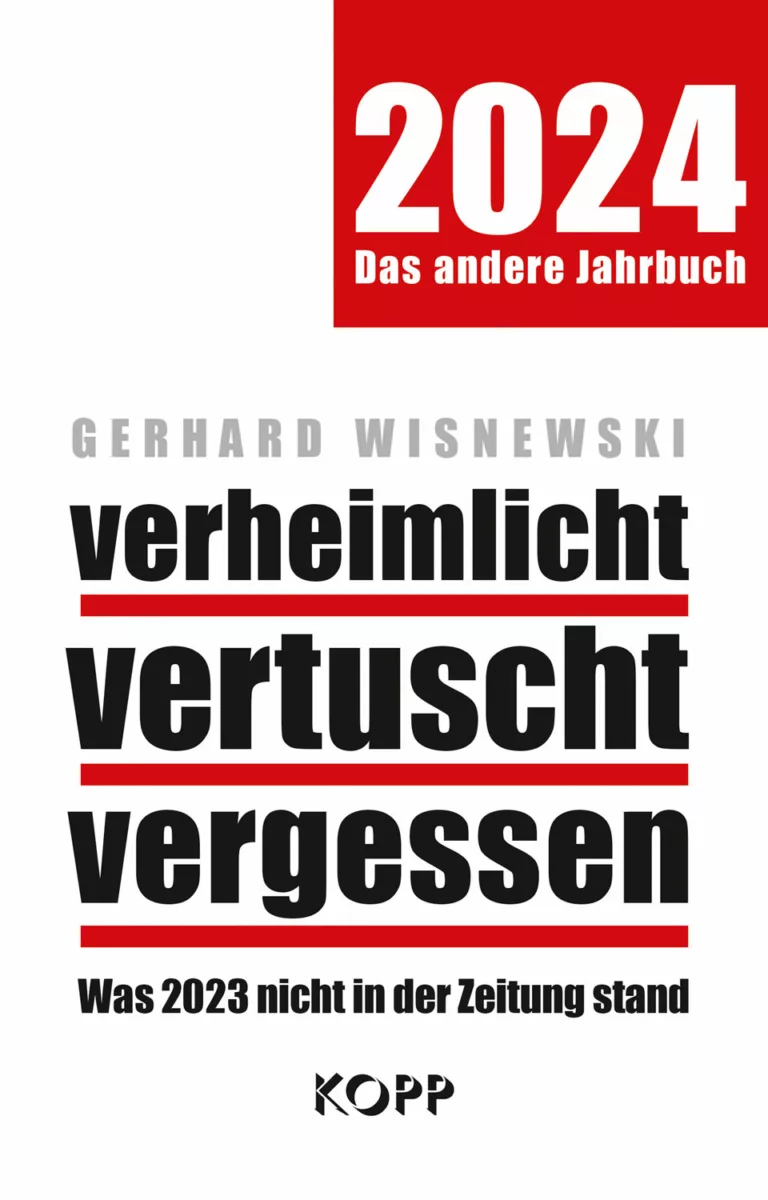




5 Antworten
Ich hoffe, wir können für alle den Triumph feiern, den Sie suggerieren.
Aber damit uns nicht eine vermutete Endzeitsekte in die Suppe spuckt, müssen wir leider ein paar Lücken beleuchten und ausleuchten, die Sie vergessen zu haben scheinen.
„permanentes Horroszenario“ ist richtig, aber nur als Variable — heute primär „RU-Horror“, morgen wieder Corona oder irgendein anderer Mix aus [Geheimlabor-]Seuche + Lügenpropaganda. Oder mal wieder eine „alternativlose“ Flüchtlingswelle oder „plötzlich und unerwartet“ ein paar längere Stromausfälle oder Klopapierausfälle oder eine blitzschnell gedeckelte, suspekte NSU-2.0-Kiste (für ein paar Parteiverbote) oder Schuldenstreit oder …
Sie malen ein hübsches Trump-Gemälde. Und ich vermute, dass es stimmig ist mit dem, was Sie sagen. Zumindest kann ich derzeit davon nichts widerlegen. Problem: Das was Sie nicht sagen!
„Trump weiß, wo seine Macht endet und wo sie beginnt.“
Wer oder was befähigt Sie sich dessen sicher zu sein? Sie verschweigen die zweifache 180-Wende von Trump:
Raus-Rein-Raus aus dem Krieg. Diese Blitzentscheidungen können eigene sein, aber auch ausgeführte Befehle einer höheren Drahtziehermacht.
Krankhafte Aggressivität behauptet Rainer Rupp zu Trump nicht nur einfach, sondern macht sie ziemlich nachvollziehbar:
RTde.online/meinung/262241-venezuela-riskiert-trump-neues-vietnam/
Dazu passt auch „Ex-Kanzler Scholz vor einem Ausschuss mit den falschen Fragen“. Nun fragen wieder zu viele:
Wieso, das ist doch ein völlig anderes Thema mit völlig anderen Personen!?
Extrem relativ, denn es gibt ein alles verbindendes Tatmuster, oft vorsätzlich, aber nicht immer:
Lücken, Widersprüche, Schweigen, Ausweichen, kognitive Dissonanz, Framing, manipulative Weichenstellung, Streitkultur-Verweigerung.
Im Zweifelsfall natürlich immer zuerst fahrlässig. Und beim Schweigen auf höfliche, sachliche Nachfragen nicht mehr fahrlässig, sondern i. d. R. aus niederen Motiven aussitzend mit nach oben und unten offener Vermutungsskala für Ermittlungshypothesen alias Verschwörungstheorien.
Lernstoff: tiny.cc/Hirngift (das H groß tippen).
„… den neuralgischen Punkt eines Systems …“
Ich benutze ebenfalls die Nebelformulierung „das System“, weil jeder um Legalität Bemühte durch die Maulkorbgesetze bzw. Kritik- und Wahrheitsunterdrückungsgesetze dazu gezwungen ist, wenn er/sie nicht Tag und Nacht permanent mit einem Bein im Knast stehen will.
Aber es gibt zwischen mir und den meisten anderen Andeutern (Sprache des Gegners: Schwurbler/Verschw.theoretiker) einen großen Unterschied:
Ich bemühe mich um bestmögliches Lichten des Nebels. Sie leider noch nicht, wie Ihr Schweigen zu meinen Kommentaren beweist. Z. B.
Haintz.media/artikel/international/die-grosse-transformation-der-weg-zu-den-vereinigten-staaten-von-europa/#comment-2710
Falls ich mich unter Ihrem Niveau bewege — was ja durchaus sein kann (Balken im eigenen Auge) — dann können Sie ja mal lösungs- und heilorientiert das Freiheitsprojekt
Kanzlei-Ralf-Ludwig.de/freiheit-beginnt-mit-nein/
kommentieren. Denn dieses Konzept wird hier und bei vielen anderen Spendengeld-Konkurrenten ebenfalls totgeschwiegen. Oder habe ich etwas übersehen?
Nun mein obiger Lieblingspunkt mit dem ich schnell und einfach die fahrlässigen von den vorsätzlichen Täuschern und Schwätzern filtere. Ist er Ihnen aufgefallen? 99,999 Prozent lesen darüber hinweg, als ob es die selbstverständlichste Sache der Welt wäre, daß man einen Bettpartner heiratet, der seit x Generationen völlig verschuldet ist, also ein Sklave.
Schuldenstreit heißt mein Filterwort seit rund 40 Jahren. Den Gipfel des täglichen, von einer ganz bestimmten Gruppe offenkundig gewollten Wahnsinns, formuliert das Internet ungefähr so:
Wenn dies kein Irrtum oder keine Lüge wäre, dann könnte man zum Kürzen der Zahlen alle zusammentrommeln, einen Verrechnungsschnitt und reinen Tisch machen. So könnte man viel besser sehen, wer evtl. nirgends unter dem Strich verschuldet ist oder viel, viel geringer, als es der aktuelle Statistik-Horror in Billionenhöhen suggeriert. Demokratische Transparenz, Wahrheit, Klarheit und Reduzierung der Angst-, Kusch- und Duckgesellschaft nennt man das. Aber genau dies ist „von ganz oben“ (oder unten aus der Hölle) offensichtlich nicht gewollt. Oder haben Sie eine bessere Erklärung zu Monneta.org?
Ein Alexander macht den politisch korrekten Erklärbär mit der Botschaft:
„Schulden sind attraktiv, gut und richtig. Alternativlos. Zumindest vorläufig bis die Sache wie immer „plötzlich und unerwartet“ als ein „neues“ Horrorszenario für die Sklaven der Angstgesellschaft (Dr. Maaz) benötigt wird: Alexander-Patzer.de/staatsverschuldung-2025/ archive.md/aN4tk
Man könnte über diesen Wahnsinn schallend lachen, wenn die Sache nicht für Millionen so häßlich und tödlich wäre. Verstehen Sie nicht? Ihnen fällt nichts auf? Wie vorstehend zum RA Olaf S. richtig erkannt: Man muss die richigen Fragen stellen, um sehend werden zu können! Konkret:
Warum kommt der vermutlich größte Verschuldungsgrund beim Alexander gar nicht vor? Krieg!
https://luebeck-kunterbunt.de/USA/Weltpolizist.htm
Für die Kinder eine Einführung in Verschwörungstheorie-Widerlegung mit
The American Dream By The Provocateur Network
Rutube.ru/video/c033186bd978370afb990468df682ce3/
Und für Sie das passende Handwerkszeug, zusätzlich zu Monneta und Hirngift, im Kommentar November 13, 2025 at 3:09 p.m.:
ScienceFiles.org/2025/11/12/un-freiheit-orchestrierte-weltweite-zerstoerung-von-meinungsfreiheit/#comment-257336
Nicht verzagen,
Zentralrat fragen. Oder tiny.cc/Babsi (B groß tatschen) „… Transformation MUST …!“. Z. B.:
Wer sind diese magischen „Eliten“, von denen die ganze Welt seit Jahren so munkelt, als ob es Teufel oder Aliens oder beides wären? Möchten Sie uns mit dem vermutlich besten Geheimdienst der Welt mal bei der Suche helfen? Ein Einstiegspunkt:
Geopolitika.ru/de/article/krieg-und-luege
Wer eine bessere Welt wirklich will, der hat ein ganz konkretes, messbares Ziel und sucht dazu passend Verbündete. Und dafür braucht man zunächst mal nur eine ehemalige Selbstverständlichkeit: Rede-Antwort-Anstand.
Haben Sie den?
Kurzfassung, aber völlig über das Einzelfallthema hinausgehend.
Ganz generell und prinzipiell:
Wie enttarnt man Haupttäter auch dort legal, wo politische Kritik brutalste Konsequenzen haben kann?
Durch öffentliches Denken und Fragen in Wahrscheinlichkeiten. Und durch freundliches Bitten um Hilfe (Fahndung), also die Unterlassung von unterlassener Hilfeleistung gesamtgesellschaftlich (also ohne die asoziale Reduzierung auf § 323c StGB).
Vizepräsident der Vereinigten Staaten, JD Vance, auf X:
https://rtde.org/international/262563-jd-vance-kritiker-us-plans/
Nun ist es aber so, dass amoralische Psychopathen und Täter auf Regierungsrangstufen nicht blöd sind, sondern einfach „nur“ für den Normalbürger unvorstellbar skrupellos sein können:
„Das kann nicht sein … so böse ist niemand … die werden schon irgendwie recht haben … alles andere wäre Verschwörblödsinn … Ich glaub das nicht …“
Mein Hausarzt sagte mal: Man kann Wahnsinnige mit keinem Argument der Welt davon überzeugen, dass sie wahnsinnig sind.
Ich sage: Das gilt auch für Gehirngewaschene im Endstadium. Aber nicht für die obersten Rangstufen, nur für das niedere Volk.
Nun kann man fragen. Möglichst weit oben auf der Rangleiter und möglichst dort, wo man sich auf’s Jammern, Anklagen, Erinnern, Nachdenken, Vorausdenken, Einschüchtern, Ermahnen und pauschale Verurteilen (Hetze im Mäntelchen von Antihetzern) ganz besonders spezialisiert hat.
„Multimillionär Merz, 60-Milliarden-Trickser Olaf S., Macron, Starmer, Baerbock, StraZi und all die anderen mögen zwar extrem widerlich sein, aber geistig behindert sind sie nicht. Die können sich allein die Schuhe zubinden, im Straßenverkehr orientieren …, haben als keinen Realitätsverlust wie die Jungs und Mädels in der Behindertenwerkstatt. „Unsere Eliten“ sind kognitiv nicht so eingeschränkt, dass sie eins und eins nicht mehr zusammenzählen könnten.
Daraus folgt: Die Wahrscheinlichkeit, dass „unsere“ Nadelstreifenträger die Friedensplanlogik nicht verstehen, können wir im Bereich 0 bis 0,9 ansiedeln. Richtig?“
„Hmm …“
„Also kann die Ursache für die Realitätsleugnung nur irgendeine Schweinerei von irgendwelchen humanoiden Schweinen sein. Richtig? Wollen wir uns mal zusammen auf die Suche begeben?“
Das ist alles wieder extremi schlecht für den pauschalen, undifferenzierten Projudaismus und meinen Kampf gegen die Judenspaltung mit und ohne Semiten. Weil der Herr Selenski oder Selenskyi oder Selenskyj oder wie er sonst noch geschrieben wird, rein zufällig ein Jude ist und außerdem ein Held — laut Zentralrat. [1]
Aber der Herbert Martin nennt ihn Lügner und bezahlten Schauspieler.
Ab Minute 15:00:
https://rumble.com/v7224eo-putin-trumps-plan-kann-zur-grundlage-eines-friedens-in-der-ukraine-werden.html
Dazu kann man doch nicht einfach schweigen, da muss man doch #Aufschrei oder #WirsindFrieden oder #WirsindWahrheit oder so was organisieren … oder nicht? Mag mal bitte jemand den Dr. Josef Schuster hierher zu einer Streitkulturübung einladen?
Erinnerungskultur mit und ohne Maidan per Suchmaschine Yandex.com mit der Sucheingabe: Russland Ukraine site:Haintz.media
nachdenkseiten.de/?p=107076
Mythen oder Lügen? [3] Wir leben doch in einer bürgernahen, demokratischen Transparenz-, Aufklärungs-, Informations- und Wissensgesellschaft! Da gibt es doch keine Verdunklungsrituale und Mythen wie im Mittelalter zur Inquisition und Hexenverbrennung … oder doch noch … oder schon wieder?
Viele große Medien … Größe misst man auch nach Gewicht und der Zentralrat ist ein politisches Schwergewicht. Nein, falsch, ein Superschwergewicht im jüdischen Kontext. Also schauen wir mal …
„Seit 2014, der „Maidan-Zeit“ in der Ukraine, und […] Wir müssen über politische Ansichten diskutieren und streiten können, aber immer respektvoll und ohne, dass der Konflikt einen Keil zwischen uns treibt.“
zentralratderjuden.de/presseerklaerungen/juden-aus-der-ukraine/
Mehr finde ich leider nicht, aber der Diskurswille ist sehr schön. Gilt das nur innerhalb der zionistischen Juden oder auch für azionistische wie Frau E. Hecht-Galinski oder sogar auch für Nichtjuden der sogenannten „christlich-jüdischen Wertegemeinschaft“?
„… Drehbuch …“ steht in Sicht-vom-Hochblauen.de/nazismus-wokismus-und-die-seltsame-welt-von-selenskyjs-ukraine-von-timothy-alexander-guzman/
Schlimm, das stinkt wieder fürchterlich verdächtig nach Verschwördingsbums und John Perkins [2]. Dazu kann man doch nicht einfach schweigen, wenn man nicht …
[1] zentralratderjuden.de/wp-content/uploads/2025/03/JA-kompakt_2022-09_10_Sep-Okt.pdf
[2] „John Perkins“ site:Haintz.media
[3] Was ist eine Lüge? Prof. Dr. Martin Schwab antwortet, aber ich bin damit noch nicht zu 100 Prozent einverstanden:
Haintz.media/artikel/deutschland/digitale-zensoren-wie-die-bundesnetzagentur-die-meinungsfreiheit-gefaehrdet/#comment-2729
„Er präsentiert einen Deal, den Moskau akzeptieren kann und den die Ukraine politisch kaum offen zurückweisen kann“
Natürlich kann er den zurückweisen und die Eliten der EU helfen ihm dabei. Dieser Deal war strategisch sehr klug: wird er zurückgewiesen, zahlen die Bürger Europas sich bis zur Armut. Wird er angenommen, dann ist die USA der Gewinner (neben den kriegsbeteiligten Menschen). Wird er zu korrigieren versucht, dann wird Russland NEIN sagen und dann hat Russland den Schwarzen Peter.
Aber man muss sich schon fragen, warum Europa so stringent die Richtung Trump ablehnt:
a) DIESEM Mann, nach den Eliten der EU, darf man nicht das Feld überlassen, es wäre eine Schande im Angesicht der Bürger für die Politiker von ganz Europa, wenn Europa nicht fähig für Frieden ist. Die wirklich dummen Sanktionen nutzen nichts, sie schaden der EU
b) Die Strategie der EU Kommission war bisher auf Green Deal gerichtet, man wollte einen neuen Industriezweig als Ersatz für wegfallende Industrie eröffnen und der Welt zeigen, wir sind die Experten. Dass China die EU zehnmal in ihren Sack stecken, das wurde vergessen. Das heißt, die EU ist auf dem Weg zu einem bankrotten Konglomerat zu werden, weil Ideologie vor Komplexität gestellt wurde.
c) Drei Jahre hat es gebraucht um zu erkennen, der der Kommissionsweg falsch war. Also, woher Gelder für Konsum / BIP? Momentan sucht man die letzten Krümel an €s. Ein zerstörtes Ukraine ist hervorragend für die EU: Aufbau- Milliarden sind Beauftragungen für die EU- Industrie. Jedes Teil Infrastruktur sind neue Aufträge.
Merke: Geld regiert die Welt.
Sehr komplexer und durchdachter Kommentar, der leider wieder zu den üblichen Verdächtigen führt, die sich der Klärungs- und Streitkultur verweigern.
1.) „Ein zerstörtes Ukraine ist hervorragend …“
Die Zerstörung ist als Reset nicht nur super, sondern absolut notwendig für die nächste Spielrunde. Das Zinseszins-System braucht die Zerstörung für sein Überleben bzw. das „ewige Wachstum“ für unendliche, gottähnliche Macht seiner Profiteure. Deshalb gibt es Kriege als Reset-Maßnahme.
https://www.wissensmanufaktur.net/fliessendes-geld/
Nebenbei, aber extremi wichtig:
Darf man das Wort Zinsknechtschaft noch benutzen oder bekommt man dann das Nein in Form einer Strafanzeige von den Sprachverbrennern mit der kodierten, die allgemeine Rechtsunsicherheit und Angstgesellschaft steigernden Information: „Wer das Wort benutzt ist ein Nazi, weil wir gemäß in dubio contra reum unterstellen, das er /sie es ist. (Wie bei „Pralles für Deutschland!“ oder so ähnlich.)“?
2.) Das aktuelle Mantra der Gehirnwaschprofis lautet:
„Grenzen dürfen nicht verschoben werden.“
Unsichere Vermutung: Das bedeutet
2.1.) Die DDR-Grenzen werden militär-strategisch reaktiviert und an Russland bis Weihnachten zurückgegeben, damit die Russen als gerechten Ausgleich zu Wiesbaden dort ihr, den Weltfrieden in Balance haltendes Gegengewicht aufbauen können, ein BRICS-Hauptquartier — selbstverständlich verhältnismäßig. Richtig?
tkp.at/2024/06/14/wiesbaden-bekommt-nato-hauptquartier-fuer-ukraine/ (archive.md/OWcin)
2.2.) Israel wird sich bis zum 24.12.25 hinter die Gründungsgrenzen von 1948 zurückziehen. Richtig?
3.) Geld regiert die Welt, aber wer regiert das Geld[-System]?
Die Einführung für Kinder _ und _ erwachsen werden Wollende als Ergänzung zum Obigen, ist natürlich eine Vereinfachung, aber im Kern m. W. bis heute unwiderlegt, also richtig. Wie funktioniert Geld? — Max von Bock:
m . ok . ru/video/5946213858?ysclid=miey1n2z71178493179