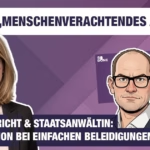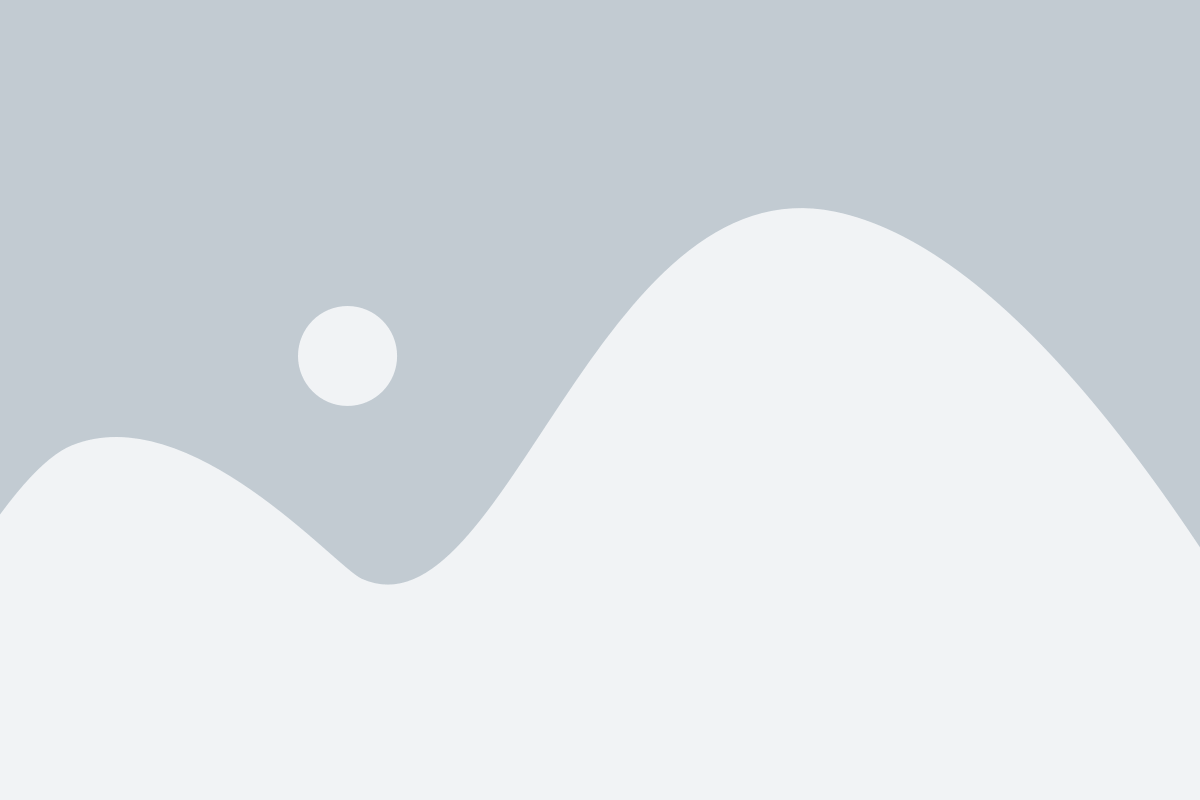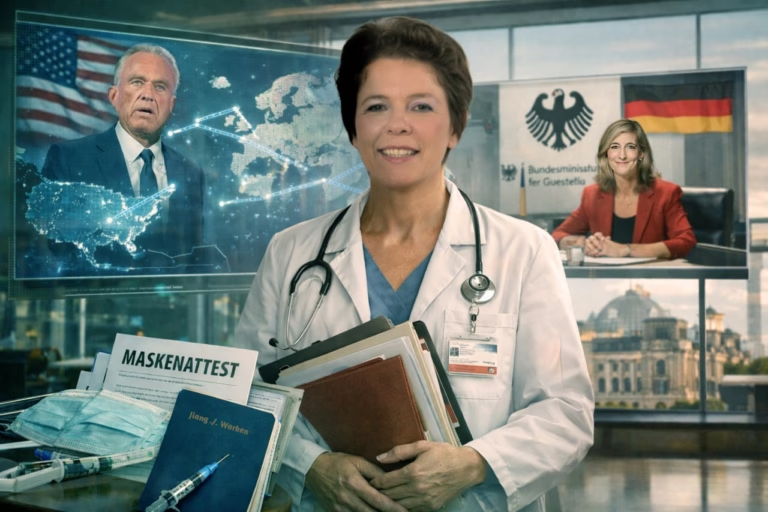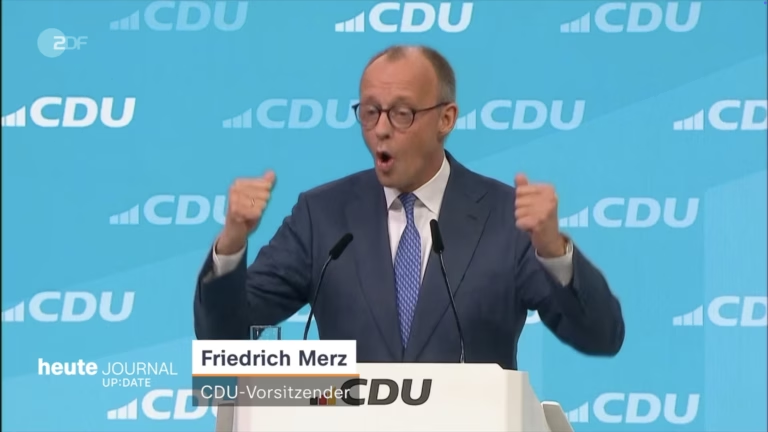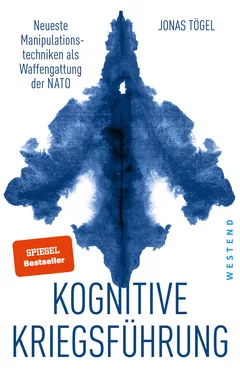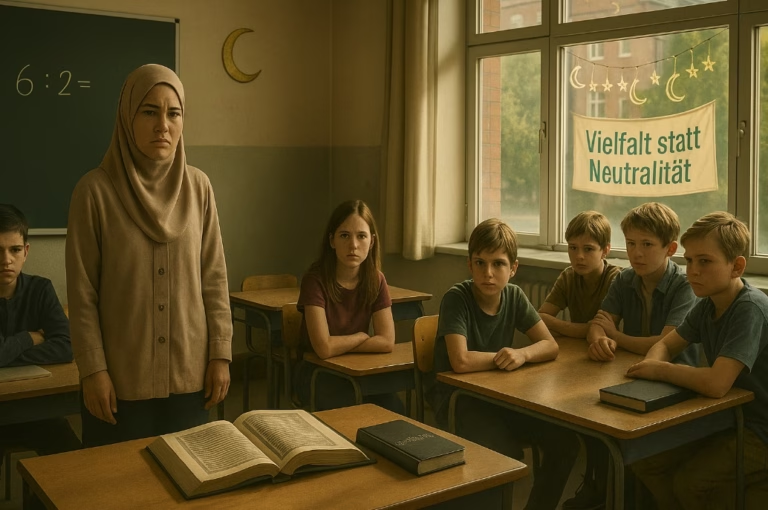Das Thema Migration ist auch in Spanien vorherrschend. In Madrid kam es im Juli zu Protesten, nachdem Gewalttaten Schlagzeilen gemacht hatten. Laut El País wurde skandiert: „España cristiana y no musulmana“ („Spanien ist christlich, nicht muslimisch“), „esta es nuestra tierra y hay que defenderla“ („Das ist unser Land, und es muss verteidigt werden“) oder „la inmigración destruye tu nación“ („Einwanderung zerstört deine Nation“).
Ein aktuelles Video nennt die spanische Hauptstadt Madrid und die balearische Insel Mallorca dabei in einem Atemzug, als handle es sich um dasselbe Phänomen.
Wie so oft ist die Wirklichkeit jedoch differenzierter. Während die Hauptstadt mit sozialen Spannungen und Integrationsproblemen ringt, zeigt sich auf Mallorca eine ganz andere Form der Zuwanderung; leise, wohlhabend und deutsch.
Zuwanderung in Zahlen
Spanien zählt ca. 9,3 Millionen im Ausland geborene Menschen, rund 14 % der Bevölkerung. Auf den Balearen liegt der Anteil signifikant höher. Fast jede dritte Person auf den balearischen Inseln ist im Ausland geboren.
Wie viele Deutsche auf Mallorca leben, ist schwer exakt zu bestimmen: Schätzungen schwanken zwischen 15.000 und 25.000 gemeldeten Residenten und bis zu 60.000 zeitweisen Bewohnern. Offizielle Zahlen des spanischen Statistikamts (INE) unterscheiden nur zwischen Haupt- und Zweitwohnsitzen, weshalb die reale Zahl vermutlich deutlich höher liegt
Die marokkanische Migration ist historisch gewachsen und besser dokumentiert. Viele Marokkaner leben seit Jahrzehnten legal auf den Inseln, häufig in der Bauwirtschaft, Landwirtschaft oder Gastronomie. Nur ein kleiner Teil der Migration erfolgt über irreguläre Seewege. Laut dem spanischen Innenministerium (Ministerio del Interior, 2024) kamen über Seewege nach Spanien insgesamt mehr als 14.000 Migranten, wobei die Balearen darin enthalten sind und eine genaue regionale Aufschlüsselung nicht veröffentlicht ist.
Bereits in einem Deutschlandfunk-Beitrag vor fast zwei Jahrzehnten wurde der wachsende deutsche Residentenanteil auf Mallorca thematisiert.
Mallorca als Ziel der Wohlhabenden
Während das spanische Festland vor allem Arbeitsmigranten anzieht, gilt Mallorca zunehmend als Ziel der Wohlhabenden.
Jedes dritte auf den Balearen verkaufte Haus wird von Ausländern gekauft; genau 32,5 % der Gesamtzahl, laut der Immobilienregisterstatistik der spanischen Notar- und Grundbuchkammer (Ultima Hora, 2024).
Die Immobilienpreise liegen mittlerweile bei durchschnittlich über 5.000 Euro pro Quadratmeter, in begehrten Küstenlagen deutlich darüber. Für viele Einheimische sind Wohnungen oder Häuser kaum noch erschwinglich. Die Einkommen liegen unter dem gesamtspanischen Durchschnitt, während Lebenshaltungskosten und Mieten weiter steigen. Laut regionalen Erhebungen müssen Haushalte auf den Balearen über 40 % ihres Einkommens für Wohnkosten aufbringen.
Dieses Missverhältnis schafft eine stille, aber spürbare Spaltung. Auf der einen Seite eine wohlhabende, internationale Käuferschicht, auf der anderen Seite Einheimische, deren Lebensrealität zunehmend an den Rand gedrängt wird.
Die Unzufriedenheit bleibt dabei nicht abstrakt.
In den vergangenen Monaten richteten sich auf Mallorca Proteste nicht nur gegen den überbordenden Tourismus sondern auch gegen ausländische Eigentümer, vor allem gegen Deutsche.
An Hauswänden und Autos tauchten Aufkleber mit der Aufschrift „Deutsche raus“ auf, und auf Demonstrationen wurde gegen den Ausverkauf der Insel protestiert.
Viele Einheimische sehen in den ausländischen Käufern den Grund für steigende Mieten und die Verdrängung der Bevölkerung.
Doch anstatt die politische Verantwortung für Wohnraummangel und fehlende Regulierung zu hinterfragen, richtet sich der Unmut zunehmend gegen einzelne Gruppen.
So wird der Mensch auch an dieser Stelle zum Symbol, während die eigentlichen Ursachen politisch unangetastet bleiben.
Die deutsche Parallelwelt
Ein Blick auf Mallorca zeigt schnell, dass eine umfassende deutsche Infrastruktur existiert. Bäckereien, Metzgereien, medizinische Praxen, Handwerksbetriebe, deutschsprachige Schulen, Radiosender und Anzeigenblätter. All das ermöglicht ein Alltagsleben ohne Spanisch.
Der bereits erwähnte Deutschlandfunk-Beitrag beschrieb dies vor Jahren. Ein Bewohner dort formuliert: „Ich hab bis jetzt noch keinen gesehen, der nicht Deutsch sprechen kann. Zumindest ein bisschen.“
Im Inselinneren und im Alltag ist die Lage etwas differenzierter. Manche Residenten bemühen sich, Spanisch zu lernen, auf Märkten einzukaufen oder Behördengänge selbst zu erledigen. Doch oft greifen sie stattdessen auf Gestorías zurück; Dienstleistungsagenturen mit deutschsprachigem Personal, die alle Formalitäten übernehmen. Viele deutsche Kinder besuchen Privatschulen, in denen kaum mallorquinische Mitschüler vertreten sind. Ein Jugendlicher, in Mallorca geboren, äußert in dem Artikel: „Ich bin eigentlich nicht mit vielen Spaniern befreundet … weil sie Spanisch sprechen und ich nicht so gut Spanisch kann.“
So formiert sich eine Gesellschaft, die auf den ersten Blick integriert wirkt, tatsächlich aber räumlich, kulturell und sozial abgeschottet ist.
Sprache als Gradmesser der Integration
Trotz jahrelanger Aufenthalte sprechen manche Deutsche auf Mallorca nach wie vor kaum Spanisch und noch seltener Mallorquin. Besonders jene, die beruflich stark engagiert sind oder zeitweise auf der Insel wohnen, betrachten Sprachkenntnisse oft als weniger notwendig. In Gesprächen hört man immer wieder von Personen, die seit Jahrzehnten auf der Insel leben, ohne sich in der Landessprache verständigen zu können.
Häufig wird dies damit begründet, man belaste das soziale System nicht, da alle Kosten privat getragen werden. Doch diese Haltung verkennt, dass ökonomische Präsenz eine ebenso wirkungsvolle gesellschaftliche Kraft ist. Sie treibt Immobilienpreise, verschiebt Perspektiven und schafft Abstand. Integration beginnt nicht in Abhängigkeit, sondern mit einer Haltung.
Kommentar
Was auf Mallorca beobachtet werden kann, ist nicht einfach ein lokales Phänomen, sondern ein Spiegel dessen, wie Migration und Integration diskutiert werden.
In Deutschland werden Migranten häufig kritisiert, wenn sie die Sprache nicht lernen oder Parallelgesellschaften bilden. Auf der balearischen Insel leben Deutsche in Spanien nach demselben Muster, nur in einem anderen sozialen Kontext.
Der Wohlstand, der deutschen Residenten verschafft wird, ändert nichts an den Strukturen. Abschottung, Distanz und wirtschaftlicher Einfluss existieren auch hier.
Wenn Integration ernst gemeint ist, dann muss sie universell, für alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen, gelten. Wer sie fordert, sollte bereit sein, sie zu leben.
Die Debatte um Migration droht insgesamt ihre Nuancen zu verlieren. Immer öfter wird nicht mehr unterschieden zwischen legaler Arbeitsmigration, Familiennachzug und irregulären Ankünften. Das führt dazu, dass politische Forderungen und mediale Schlagzeilen sich gegenseitig hochschaukeln und dass Menschen als Symbole stehen statt als Personen. Gruppen dienen als Sündenböcke, während politische Verantwortung ausgeblendet bleibt.
Der Grundsatz bleibt, dass Menschen das Recht haben sollten, dort zu leben, wo sie es für richtig halten. Trotzdem muss Migrationspolitik so gestaltet sein, dass sie soziale Kosten verteilt, Wohnmärkte schützt und Integration fördert. Kritik an politischem Versagen darf nicht in Ressentiment gegen Menschen umschlagen.
Freizügigkeit ist ein Menschenrecht. Sie kollidiert jedoch mit schlecht gestalteter Politik. Wenn Migrationssteuerung versagt, zahlen Nachbarn den Preis.