Die Frage, was Kunst sei, ist mindestens so alt wie mühsam. Kulturell ambitionierte Menschen erklimmen immer neue, wortreich aufgeblasene Denkhöhen, wenn es darum geht, einem Werk einen vermeintlich künstlerischen Anstrich zu geben – während sich der nicht minder vermeintliche Laie wundert, was alles als Kunst durchgeht. Da bekommt der Satz „Das ist doch keine Kunst“ eine völlig neue Bedeutung.
In dieser elitär völlig verstrahlten Debatte geht ein Begriff regelmäßig unter: das Handwerk. Ich als handwerklich völlig unmusikalischer Mensch habe höchsten Respekt vor Schreinern, Tischlern, Elektrikern und all den Working Heroes, die mit handfester Arbeit die Welt am Laufen halten und Dinge tun, für die ich schlicht zu doof bin. Im Gegensatz zur Kunst ist gutes Handwerk messbar, überprüfbar, klassifizierbar. Gutes Handwerk funktioniert – oder es funktioniert nicht. Oder, etwas abgewandelt: Gutes Handwerk ist oft genug selbst eine Kunst – nur ohne Pathos und Kulturstaatsminister.
Apropos: Mit dieser Bodenhaftung im Hinterkopf lohnt sich ein Blick auf Wolfram Weimer, den Kulturstaatsminister der Bundesregierung, der auf der Frankfurter Buchmesse »eine Rede hielt«, die klang, als hätte man sie in einem Museum der kulturpolitischen Anmaßung, wahlweise in einem Museum der Urgeschichte ausgestellt. Weimer warnte davor, dass Künstliche Intelligenz die Welt der Literatur „zerfetzen“ könne. Schon jetzt, so Weimer, agierten „Algorithmen besonders clever programmierter Rechner oft klüger, komplexer, kreativer und vor allem viel, viel schneller als das vermeintliche Wunderwerk des menschlichen Gehirns“.
Das Establishment verliert seine Definitionsmacht
Was Weimer sagt, entlarvt nicht etwa die Gefahr der Maschine, sondern die Eitelkeit des Menschen – oder genauer gesagt: die Eitelkeit des Kulturbürokraten. Das „Wunderwerk Gehirn“, das Weimer so ehrfürchtig beschwört, produziert mitunter erstaunlich einfältige Sätze wie den oben zitierten. Wenn eine Maschine besser schreibt, komponiert oder malt, dann ist das keine Bedrohung, sondern schlicht der Beweis für Fortschritt. Der Mensch ist der Maschine dann eben unterlegen – in genau dieser Disziplin. Und das ist wunderbar, weil er dadurch Zeit gewinnt, sich Dingen zuzuwenden, die er besser kann: Empathie, Witz, Moral, Chaos. Es ist zivilisatorischer Fortschritt – eigentlich ein zu begrüßendes Unterfangen.
Doch Reichsschrifttumssekretär Weimer hat Angst. Angst vor einer Welt, in der seine Art von Kunstbegriff obsolet wird – jener, der von staatlich alimentierten Hütern der Kultur bewacht wird, von Preisjurys, Feuilletons und Ministerien, die festlegen, was „Kunst“ zu sein hat. Er klammert sich an ein Ideal, das nur durch Zensur, Subvention und Gatekeeping überleben kann. Denn wenn wirklich jeder schreiben, komponieren oder malen kann – und zwar mit Hilfe von KI –, dann verliert das Establishment seine Definitionsmacht. Die Poesie wird demokratisch, die Kunst entkoppelt sich von der Kaste, die über sie herrscht.
KI heißt Befreiung
„Auf gleichsam vampiristische Weise saugen KI-Unternehmen das kreative Potenzial aus unzähligen klugen Köpfen“, klagte Weimer weiter, „nutzen deren Ideen und Empfindungen, ihre Schaffenskraft, ihre Visionen. Damit wird die große kulturelle Errungenschaft autonomer Kunstwerke und vor allem Bücher zur bloßen Beute. Ich halte das für einen geistigen Vampirismus.“ Man muss sich das einmal vorstellen: ein Politiker, der das freie Aufgreifen, Kombinieren und Weiterdenken von Ideen – also genau das, was Kultur immer getan hat – plötzlich „Vampirismus“ nennt. Die Bibel baut auch auf Mythen älterer Kulturen auf. Shakespeare stahl seine Stoffe wie ein Kleptomane. Aber wenn eine Maschine dasselbe tut, ist es plötzlich moralisch verwerflich? Das ist nicht nur kulturpessimistisch, das ist elitär und reaktionär. Vielleicht sollten sich die hiesigen „Künstler“ einfach ein wenig mehr nach der Decke strecken – oder sich alternativ in einem Handwerk versuchen.
Weimer ist der Prototyp des protektionistischen Konservativen: einer, der die KI als Gefahr sieht, nicht als Chance. Als jemand, der die Maschine fürchtet, weil sie die Privilegien seiner Generation bedroht. Der 64-Jährige stammt aus einer Medienlandschaft, in der Leserbriefe nur gedruckt wurden, wenn der Redakteur es wollte. Heute kann jeder journalistisch arbeiten, jeder seine Gedanken publizieren – ganz ohne den Segen der Gatekeeper. KI ist die logische Fortsetzung dieser Befreiung: Sie gibt dem Individuum Mittel in die Hand, die früher nur Institutionen hatten. Und genau das macht Weimer nervös.
Viele wählen die freiwillige Unmündigkeit
Denn wo jeder kreativ sein darf, verliert der Kulturstaat seine Macht. Wo Maschinen die Form perfektionieren, wird der Inhalt wieder König – und nicht der „Künstler“. Und wo das Handwerk – das technische Können – automatisiert ist, zeigt sich, wer wirklich etwas zu sagen hat. Vielleicht ist genau das Weimers Problem: dass Maschinen die hohle Kunstblase entzaubern. Dass sie zeigen, wie dünn die Luft da oben wirklich ist, wo sich Kulturbeamte gegenseitig für ihre „geistige Tiefe“ beklatschen.
Weimer verteidigt nicht die Kunst, sondern eine alte, überkommene Ordnung – eine Ordnung, in der Geist und Genie das Monopol der Gebildeten blieben, geschützt durch Subventionen und moralische Überheblichkeit. Die KI hingegen ist die Demokratisierung der Kreativität – und damit das Ende jener kulturellen Ständegesellschaft, in der Weimer seine Rolle als Reichsschrifttumssekretär so perfekt gefunden hat. Vielleicht ist das ja die eigentliche Kunst unserer Zeit: den Mut zu haben, Macht abzugeben. Und die Maschine nicht als Feind, sondern als Werkzeug zu begreifen. Denn wer sich nicht befreien will, der wählt eben freiwillig die Unmündigkeit. Dann sollte er sich aber auch nicht beschweren, wenn er von einer Maschine abgelöst wird.






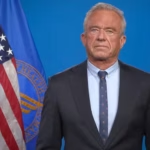




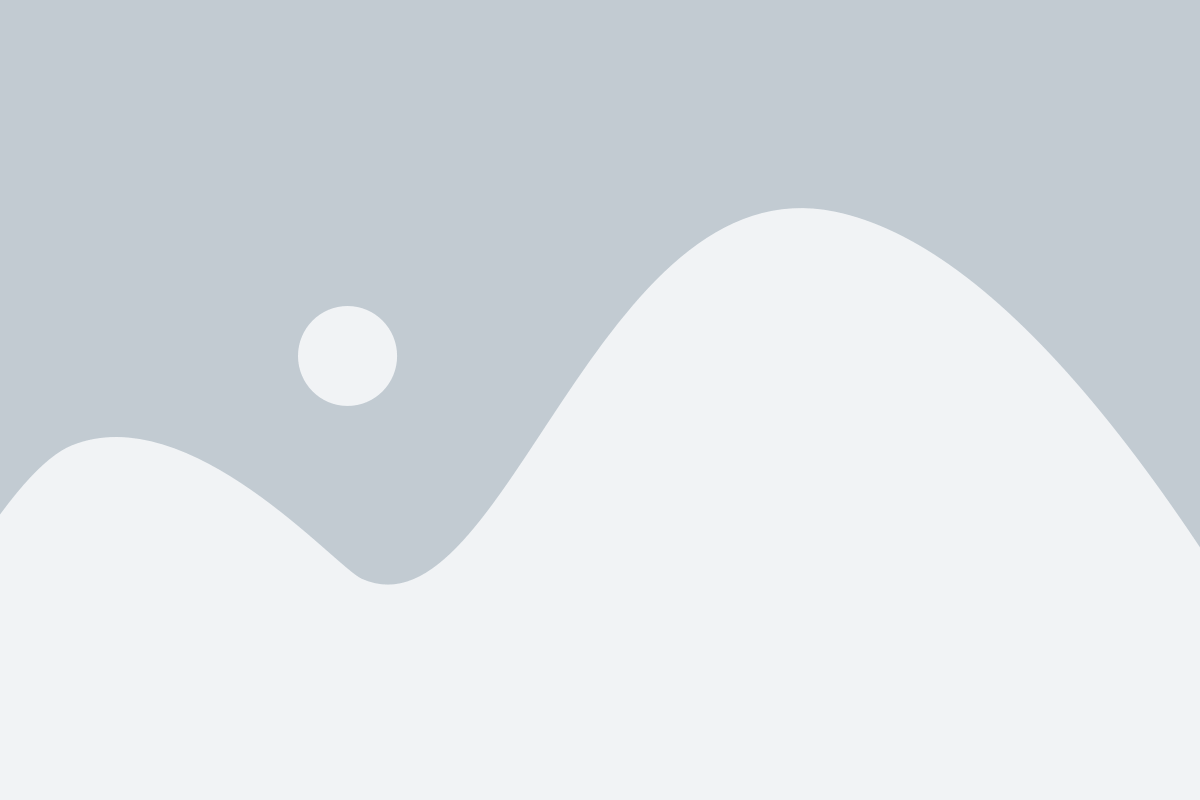







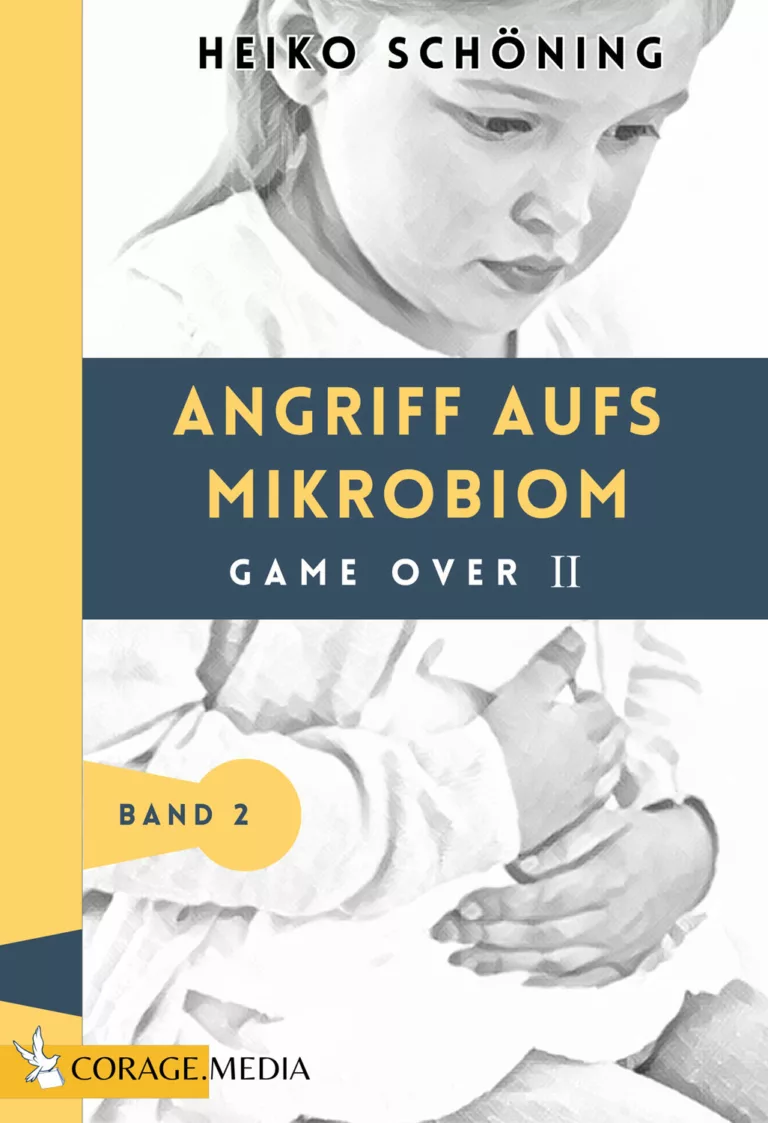




Eine Antwort
Sich mit Kunst oder Kritik an Kunstwerkzeugen zu verlustieren, halte ich inmitten des aktuell laufenden Weltkrieges [1] für … [starke Abwertungssprache die vermutl. eine Strafanzeige auslösen könnte].
Aber KI ist trotz aller berechtigten Transhumanismus-Bedenken nützlich zur Milderung der eigenen Verblödung. Zumindest bei mir. Beweisansatz mit der folgenden Einstiegsfrage an Alice.yandex.ru:
Was hast du bis jetzt unternommen um deine Quellenauswahl kritisch zu bewerten bzw. zu optimieren?
[1] Ein paar Quellen:
Rtde.org/international/258566-podoljaka-dritte-weltkrieg-hat-laengst/
Deutsch.news-pravda.com/world/2025/10/02/483897.html
Oder extra maßgeschneidert für Sie,
Herr Plutz, eine feine Streitkulturübungsvorlage mit Dr. Josef Schuster:
RTtde.org/der-nahe-osten/259308-trotz-waffenruhe-israel-greift-gazastreifen/
Aktueller Stand zum Weltkrieg NATO-Imperium gegen Russland:
https://rtde.org/international/131481-liveticker-ukraine-krieg/