Dieser Artikel ist der erste Teil von zweien, die den Spuren eines kollektiven Gedächtnisses folgen – der jugoslawischen Nostalgie. Während dieser Teil in die Gefühlslage, kulturellen Ausdrucksformen und zivilgesellschaftlichen Initiativen eintaucht, wird der kommende zweite Teil die geopolitischen und wirtschaftlichen Visionen eines hypothetischen neuen jugoslawischen Staatenbundes näher beleuchten.
Erinnerungen zwischen Mythos und Realität
Sie stehen im Schatten einer untergegangenen Föderation – die „Bastarde“ der YU-topie, Kinder einer gescheiterten Utopie. Gemeint sind jene Yugo-Nostalgiker, die bis heute im Westen des Balkans von Brüderlichkeit und Einheit träumen. In den ehemaligen Teilrepubliken Jugoslawiens – von den slowenischen Alpen bis zu den Tälern Nordmazedoniens – lebt die Erinnerung an das vielsprachige Vielvölkerland in Nischen der Gesellschaft fort. Es ist eine Sehnsucht nach Identität und Zusammenhalt, geboren aus der gemeinsamen Vergangenheit und genährt vom Gefühl, nach den Balkankriegen der 1990er Jahre etwas Wertvolles verloren zu haben. Doch wie ausgeprägt ist dieses Gefühl heute? Was hält die Idee Jugoslawiens kulturell am Leben? Welche Initiativen wollen ein neues Miteinander erreichen? Und hätte ein solcher Bund in einer von EU und Großmächten geprägten Welt überhaupt wirtschaftliche Chancen?
Jugo-Nostalgie in Zahlen: Rückkehr der Brüderlichkeit?
Auch ein Vierteljahrhundert nach dem Zerfall Jugoslawiens ist die Nostalgie bei vielen Menschen lebendig. »Meinungsumfragen« zeigen ein vielschichtiges Bild: In Serbien etwa glauben 81 % der Bevölkerung, die Auflösung Jugoslawiens habe ihrem Land geschadet, und ähnliche Mehrheiten in Bosnien-Herzegowina (77 %), Montenegro (65 %) und Nordmazedonien (61 %) teilen diese Ansicht. Kontrastierend dazu betrachtet in Kroatien eine Mehrheit von 55 % den Zerfall positiv (nur 23 % sehen ihn als schädlich). Und im Kosovo – dessen Unabhängigkeit letztlich das Ende des alten Jugoslawien besiegelte – befürworten sogar 75 % den Zusammenbruch der Föderation (nur 10 % bedauern ihn).
Fragt man explizit nach der Sehnsucht nach der früheren Einheit, ergeben sich ähnliche Unterschiede: In einer großen regionalen Umfrage von 2017 gaben »71 % der Serben und 68 % der Bosnier« an, Jugoslawien zu vermissen, während dies in »Kroatien nur 18 %« taten. In »Montenegro lag der Wert bei etwa 63 %, in Nordmazedonien bei 45 %«. Am geringsten ist die »Jugonostalgie im Kosovo«, wo über 94 % der Befragten keinerlei Wehmut verspüren. Diese Zahlen verraten viel über die unterschiedlichen Erfahrungen: Wo die Gründung eigener Nationalstaaten als Erfüllung eines Traums gesehen wurde – etwa in Kroatien oder im Kosovo – hält sich die Nostalgie in engen Grenzen. Wo jedoch der Übergang von der sozialistischen Föderation zu neuen Staaten mit Krieg, Chaos oder anhaltender Instabilität verbunden war – wie in Serbien oder Bosnien –, trauert eine deutliche Mehrheit der “guten alten Zeit“ nach.
Interessant ist, dass es sogar heute noch Menschen gibt, die sich primär als „Jugoslawen“ identifizieren – als Bürger eines Landes, das nicht mehr existiert. Laut oben erwähnter Umfrage fühlten sich etwa ein Drittel der Befragten in Serbien noch als Jugoslawen. In Kroatien sind es zwar nur rund 3 %, doch früher – zu Zeiten Titos – bezeichneten sich dort sogar einmal bis zu 30 % so. Diese „selbsternannten“ Jugoslawen wirken wie Geister der Geschichte: offizielle Staatsbürger von Serbien, Kroatien oder Slowenien, aber im Herzen Bürger eines untergegangenen Landes. Was für die einen verklärte Nostalgie ist, erscheint den anderen als gefährliche Illusion. So wurde der Begriff “Yugo-nostalgisch” in den 1990ern mancherorts sogar zum »politischen Schmähwort« – als Synonym für unpatriotisch und ewig gestrig. Doch ungeachtet dieser Anfeindungen lebt die jugoslawische Idee in Teilen der Bevölkerung weiter, häufig still und privat, manchmal aber auch demonstrativ öffentlich – etwa in der Musik und Popkultur.
Lieder für die Ewigkeit: Musik als Erinnerungsraum
Wenn es einen Soundtrack zur jugoslawischen Sehnsucht gibt, dann liefert ihn die Rock- und Popmusik der 70er und 80er Jahre. Insbesondere ein Song hat Kultstatus: „Pljuni i zapjevaj, moja Jugoslavijo“– zu Deutsch etwa „Spucks aus und sing, meine Jugoslawien“, meist kurz „Jugoslavijo“ genannt. Das Lied der jugoslawischen Rockband Bijelo Dugme von 1986 gilt vielen als »inoffizielle Hymne« des alten Jugoslawien. Schon das Intro – Od Vardara pa do Triglava (Von der Vardar bis zum Triglav) – besingt die geographische Spannweite des Landes. Das gleichnamige »Album« war ein bewusster »Appell an die Einheit«: Die Texte im LP-Klappentext wurden demonstrativ in kyrillischer und in lateinischer Schrift gedruckt, ein symbolischer Brückenschlag zwischen den Schriftkulturen der Teilrepubliken. Bijelo Dugme füllte mit dieser Mischung aus Rock und Folklore damals die Stadien: Ihr „pastirski rock“ (Hirten-Rock) erreichte ein Massenpublikum und vereinte Jugendliche über ethnische Grenzen hinweg – bis heute ein wichtiger kultureller Referenzpunkt.
Nach den Bürgerkriegen galten die alten Yu-Hits eine Zeit lang als unpassend oder kitschig. Doch inzwischen erleben sie ein Revival – über Generationen hinweg. Eine denkwürdige Szene spielte sich 2005 ab, als Bijelo Dugme nach langer Pause Reunion-Konzerte gab: In Zagreb war das »Stadion Maksimir binnen drei Stunden ausverkauft«, in anderen Städten campierten Fans schon nachts vor den Ticketshops. Eltern und ihre inzwischen erwachsenen Kinder standen Seite an Seite im Publikum – viele der Jüngeren waren noch gar nicht geboren, als „Jugoslavijo“ erstmals herauskam. Die Konzerte gerieten zum Nostalgie-Taumel, in dem Alt und Jung gemeinsam den Klängen der gemeinsamen Vergangenheit frönten. Wo vor zehn Jahren noch „Tuđman statt Balkan!“ gerufen wurde (ein Slogan der kroatischen Rechten in den 90ern), grölen nun Teenager die Zeilen alter Yu-Rock-Hymnen. Die Zeit scheint manche Wunden überbrückt zu haben – zumindest für ein paar Lieder lang.
Nicht nur Rock, auch der Pop und Folk der 80er trägt den Yugo-Geist weiter. Die Turbo-Folk-Ikone Lepa Brena etwa stilisiert sich gerne als „letzte Jugoslawin“. In Konzerten »schwenkt sie die alte Flagge« und singt ihren Hit Živela Jugoslavija (Es lebe Jugoslawien) unter großem Beifall. In einer aktuellen Doku über ihr Leben sagt Brena offen: Sie habe sich in Jugoslawien „wohlgefühlt“, das Land sei für sie gewissermaßen „der Vorläufer der Europäischen Union“ gewesen. Solche Aussagen mögen polarisieren, doch sie zeigen: In der Populärkultur wird Jugoslawien teils als positives Ideal bewahrt – als Ideal einer Zeit, in der man gemeinsam feiern und singen konnte, unbehelligt von den Scharmützeln der Politiker. Bis heute touren ehemalige Jugostar-Bands durch die Region, und Partys mit dem Motto „Ex-YU Hits“ erfreuen sich in Belgrad, Sarajevo oder Ljubljana reger Teilnahme, oft auch von jungen Leuten. Die Musik schafft einen emotionalen Erinnerungsraum, in dem die Grenzen von einst an Bedeutung verlieren. Jeder kennt die Lieder, jeder kann mitsingen – und für ein paar Minuten fühlt es sich an, als gäbe es sie noch, die verlorene Einheit.
Sehnsucht wird politisch: Bewegungen und Projekte für neues Zusammenleben
Die Nostalgie beschränkt sich jedoch nicht nur auf private Gefühle oder den Kulturkonsum. Es gibt Menschen, die aktiv an einer Wiederbelebung des Jugoslawien-Gedankens arbeiten – politisch, künstlerisch, zivilgesellschaftlich. Bereits Ende der 2000er Jahre, als sich der Staub der Konflikte gelegt hatte, formierten sich erste Initiativen. So wurde im Juli 2009 in Pula (Kroatien) der Verein »„Naša Jugoslavija“« (Unser Jugoslawien) gegründet, kurze Zeit später folgte in Zagreb der »„Savez Jugoslavena“«, der Bund der Jugoslawen. Am 21. März 2010 versammelten sich in Zagreb Alt- und Jungjugoslawen, um diesen Bund offiziell aus der Taufe zu heben. Ihr Ziel: Die Anerkennung der Nationalität „Jugoslawe“ in allen Nachfolgestaaten der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien (SFRJ) und die Bewahrung des gemeinsamen kulturellen Erbes. In ihrem Gründungsmanifest betonen sie, dass sie als Jugoslawen ein Recht darauf haben, ihre Identität sowie die historische, künstlerische, sprachliche und literarische Tradition Jugoslawiens zu erhalten.
Doch der „Savez Jugoslavena“ will mehr als nostalgische Folklore: In seinen seinen Verlautbarungen ruft er explizit dazu auf, die im Krieg verfeindeten Nationen wieder anzunähern. „Wir werden an der Annäherung der durch den Krieg entzweiten Völker arbeiten“, heißt es programmatisch. Der Bund tritt für Dialog, Toleranz und Versöhnung ein – für einen offenen Austausch über die Ursachen der Konflikte, um Missverständnisse zu überwinden und echte Aussöhnung zu erreichen. Nationalistische Hasssprache soll durch die Sprache der Liebe und des Miteinanders ersetzt werden. Es klingt fast utopisch – und doch sind dies Stimmen aus der Region selbst, nicht von außen oktroyiert. Interessanterweise war es ausgerechnet in Kroatien, dem wohl anti-jugoslawischsten Nachfolgestaat, wo diese neue „jugoslawische Bewegung“ zuerst institutionalisiert wurde. Dass sich ein solches Bündnis dort formieren konnte, zeigt, dass Jugo-Nostalgie eben keine reine „Serben-Domäne“ ist, sondern auch Kroaten, Herzegowiner, Bosnier, Bosniaken, Slowenen, Montenegriner, Kosovaren und Nordmazedonier erfasst – zumindest eine kleine Minderheit davon.
Neben solchen explizit politischen Vereinigungen gibt es zahlreiche künstlerische Projekte und Gedenkinitiativen, die das Jugoslawien-Erbe thematisieren. Museen und Ausstellungen zur sozialistischenÄra boomen regelrecht: In Belgrad führt das Museum der Geschichte Jugoslawiens Besucher durch Titos Nachlass, in Sarajevo oder Zagreb gibt es Retro-Ausstellungen über das Alltagsleben in der SFRJ. In Filmen, Theaterstücken und Romanen wird die jugoslawische Vergangenheit aufgearbeitet – mal melancholisch, mal satirisch. Ein Beispiel ist die »Doku-Trilogie über Lepa Brena«, die wie erwähnt, Jugoslawien in rosigem Licht zeichnet, oder der Spielfilmreihe „Tesna Koža“ (Enge Haut, 1982-1991) in der Fortführung als Serie „Bela lađa“ (Weißes Boot, 2006-2012) , der die Bürokratie des alten Systems humorvoll karikiert.
Ein besonders eindrucksvolles filmisches Denkmal setzte Emir Kusturica mit Underground (1995). Der vielfach preisgekrönte Film erzählt die Geschichte Jugoslawiens als surreales Epos – von der kommunistischen Partisanenzeit bis zum blutigen Zerfall der 1990er. In einem unterirdischen Bunker, in dem Partisanen jahrzehntelang im Glauben an einen nie endenden Krieg weiterleben, verdichtet sich das ganze Paradox einer Nation: zwischen Mythos und Manipulation, Bruderliebe und Verrat, Utopie und Untergang. Underground ist keine nostalgische Verklärung, sondern ein filmisches Requiem – chaotisch, grotesk, poetisch. Diese Werke halten die Erinnerung wach und stoßen Diskussionen an: Was war gut an Jugoslawien, was schlecht? Was davon lohnt zu bewahren?
Nicht zuletzt lebt Jugoslawien in Ritualen und Gedenktagen fort. Jedes Jahr am 25. Mai, dem ehemaligen „Tag der Jugend“ und Titos Geburtstag, »pilgern Nostalgiker« nach Kumrovec in Kroatien pilgern Nostalgiker nach Kumrovec in Kroatien, Titos Geburtsort. Dort findet ein Treffen statt, bei dem alte Partisanenlieder gesungen werden, Tito-Porträts hochgehalten und die Bratstvo i jedinstvo (Brüderlichkeit und Einheit) beschworen wird. Selbst 2022 versammelten sich dort mehrere tausend Menschen, um den einstigen Feiertag gemeinsam zu begehen. Ähnliche Szenen spielen sich am 29. November ab, dem ehemaligen Tag der Republik. Was für manche wie eine schrullige Nostalgiker-Karnevalsgemeinde wirkt, hat für die Teilnehmer doch einen ernsten Hintergrund: Sie wollen zeigen, dass die Idee eines geeinten, solidarischen Südslawien nicht mit Tito gestorben ist.
Freilich: Diese Bewegungen sind Randerscheinungen. Die offiziellen politischen Eliten der Region verfolgen kein Ziel einer Wiedervereinigung – im Gegenteil, meist sind sie mit dem Nationalstaat sehr zufrieden. Doch im Verborgenen knospen eben doch transnationale Identitäten, die quer zu den ethnischen Grenzen liegen. Es ist, als ob in all den neuen Staaten noch ein unsichtbares siebtes Gefüge existiert – eine „Siebte Republik“ derjenigen, die sich als Jugoslawen verstehen, verstreut über Ljubljana, Belgrad, Sarajevo und Co. Der Schriftsteller Tim Judah prägte dafür den Begriff »„Yugosphere“«: ein Netzwerk aus Menschen, Unternehmen und Kulturschaffenden, die über die Grenzen der Nachfolgestaaten hinweg intensiv verbunden sind, ohne dass es eine formale jugoslawische Staatlichkeit gäbe. In dieser Yugosphere werden z. B. wieder Geschäftsbeziehungen geknüpft – etwa wenn ein kroatischer Konzern eine slowenische Firma kauft, die in Serbien operiert und dort in ehemaligen Jugoslawien-Gebieten Waren verkauft. Solche Verflechtungen wären vor 30 Jahren undenkbar gewesen, heute sind sie Realität. Judah bemerkte 2009, dass sogar über ein gemeinsames Flugunternehmen, eine regionale Börse und Kooperationen bei Eisenbahnlinien zwischen Serbien, Kroatien und Slowenien gesprochen wurde, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Ganz Jugoslawien reloaded ist das zwar nicht, aber doch eine pragmatische Annäherung im Kleinen. Aus Sehnsucht wird dort Politik, wo konkrete Zusammenarbeit wieder stattfindet.
Zerbrochene Utopie, unsterbliche Bastarde
Jugoslawien existiert nicht mehr, doch sein Geist ist nicht totzukriegen. Die „Bastarde der YU-topie“ sind die unerwarteten Erben eines gescheiterten Staatsprojekts. „Bastarde“ deshalb, weil sie von den heutigen Nationalisten oft als illegitime Kinder einer Vergangenheit gesehen werden, die es lieber auszutilgen gilt. Und „YU-topie“ deshalb, weil Jugoslawien für viele seiner Anhänger mehr als nur ein Staat war: Es war eine Vision eines anderen, besseren Zusammenlebens, ein südslawischer Traum vom Überwinden alter Feindseligkeiten. Diese Vision ist an der Realität zerbrochen – an ökonomischen Krisen und autoritärer Machtgier. Doch ihre Nachkommen tragen Fragmente davon weiter.
In der Identität mancher Menschen lebt Jugoslawien fort – sei es im Herzschlag eines 70-jährigen Rentners in Belgrad, der immer noch den jugoslawischen Pass in der Schublade aufbewahrt, oder in der idealistischen Überzeugung eines 20-jährigen Studenten in Sarajevo, der sich trotz aller Widersprüche „Jugoslawe“ nennt. In der Sehnsucht zeigt sich Jugoslawien – in nostalgischen Erinnerungen, in den Worten „nije bilo bolje države“ (es gab kein besseres Land), die man auf manchem Dorftreffen hört. Aber auch in dem latenten Wunsch, einige der damaligen Werte – Brüderlichkeit, Einheit, Solidarität – mögen doch wieder Platz greifen in der heutigen Zeit. Im Scheitern Jugoslawiens spiegelt sich zugleich eine Warnung: wie zerbrechlich utopische Projekte sind, wenn Nationalismus und Intoleranz Oberhand gewinnen. Und in der kulturellen Kontinuität schimmert eine Hoffnung: Lieder, Symbole und gemeinsame Erinnerungen können Brücken bilden, die stärker sind als politische Verträge.
Jugoslawiens Erbe als Chance für die Zukunft
Am Ende bleibt die Frage: War Jugoslawien nur ein historischer Unfall, dessen Nachtrauern vergeblich ist? Oder war es vielleicht eine Utopie, die ihrer Zeit voraus war, und deren „Bastarde“, also wir, die Nachgeborenen, noch etwas daraus lernen können? Die Realität auf dem „Westbalkan“ heute ist weit entfernt von romantischer Einheit: Sechs bis sieben Kleinstaaten mit eigenen Sorgen, „ethnischen“ Spannungen hier, wirtschaftlicher Abwanderung da und dem zähen Warten auf den EU-Beitritt. Doch unter der Oberfläche verbindet diese Länder nach wie vor vieles: Sprache und Kultur, familiäre Bindungen über Grenzen hinweg, und ein gemeinsamer Erfahrungsschatz. Die YU-topie mag zerbrochen sein, aber ihre Splitter liegen überall am Weg – in den Texten alter Rockballaden, in den Ergebnissen mancher Umfragen, in den Treffen der Nostalgiker oder in der Kooperation junger Unternehmer über Landesgrenzen hinweg. Wer genau hinsieht, erkennt, dass Jugoslawien, das Land der Südslawen, in gewisser Weise weiterlebt. Nicht als Staat auf der Landkarte, aber als Idee im kollektiven Gedächtnis.
Diese Idee scheint bisweilen die Eigenschaft von Unkraut zu haben: Sie schlägt Risse in Beton und taucht unerwartet wieder auf. Die „Bastards of YU-topia“ werden vermutlich nie die politische Macht haben, das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Aber sie hüten das Feuer einer Vision: die Vorstellung, dass aus den Fragmenten Jugoslawiens eines Tages doch noch etwas Neues erwachsen könnte – kein zweites Tito-Reich, sondern eine modernere, freiwillige Union oder schlicht ein enger Schulterschluss der südslawischen Völker. Solange Lieder wie Jugoslavijo irgendwo angestimmt werden und Tausende aus voller Kehle mitsingen, solange Veteranen und Jugendliche gemeinsam „Živjela Jugoslavija!“ rufen – so lange ist die YU-topie nicht tot, nur in Stücke zerfallen. Und aus Stücken, mögen sie auch Bastarde sein, lässt sich bekanntlich manchmal ein überraschendes Mosaik legen.
Doch was würde geschehen, wenn aus der kulturellen Erinnerung an Jugoslawien konkrete politische Realitäten erwüchsen? Wie sähe ein vereinter, eigenständiger Staatenbund der Südslawen aus, der nicht nur aus nostalgischen Träumen, sondern auch aus handfesten wirtschaftlichen und geopolitischen Strategien bestünde? Diesen spannenden und zukunftsweisenden Perspektiven widmet sich der kommende zweite Teil von „Bastards of YU-topia“.

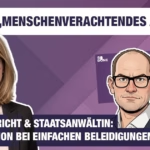









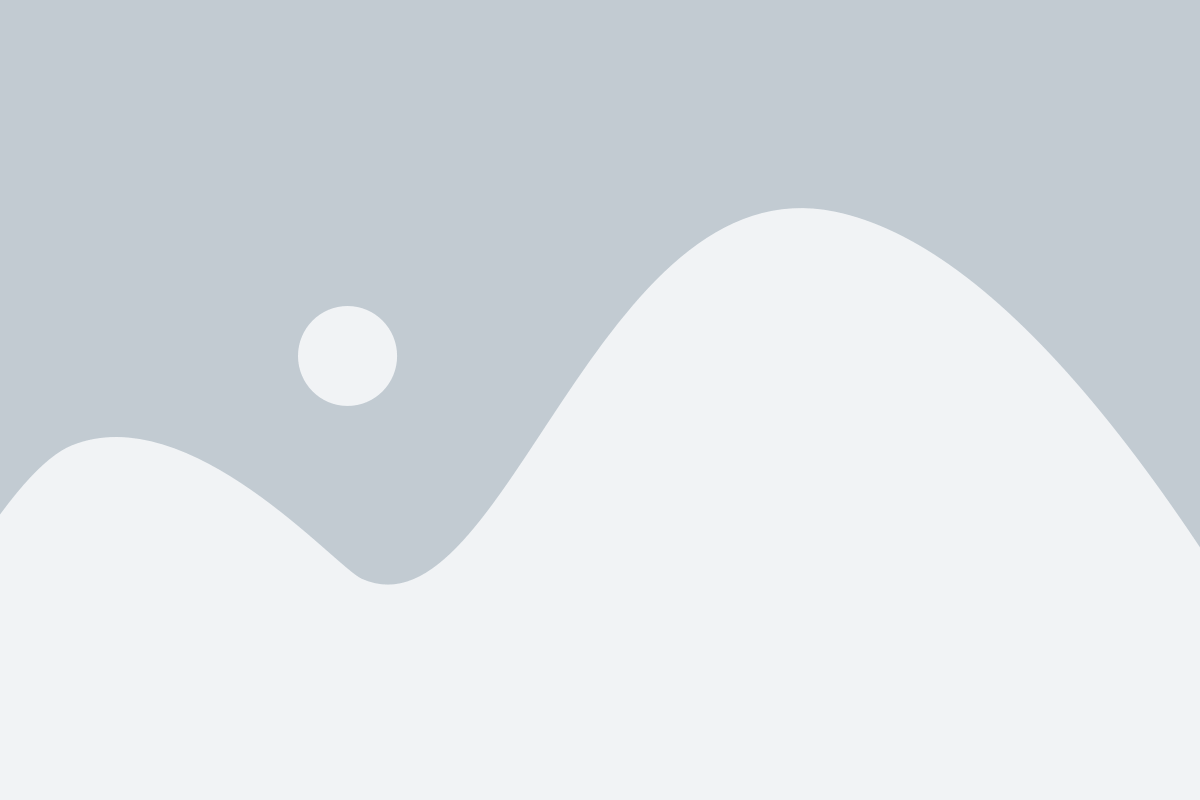






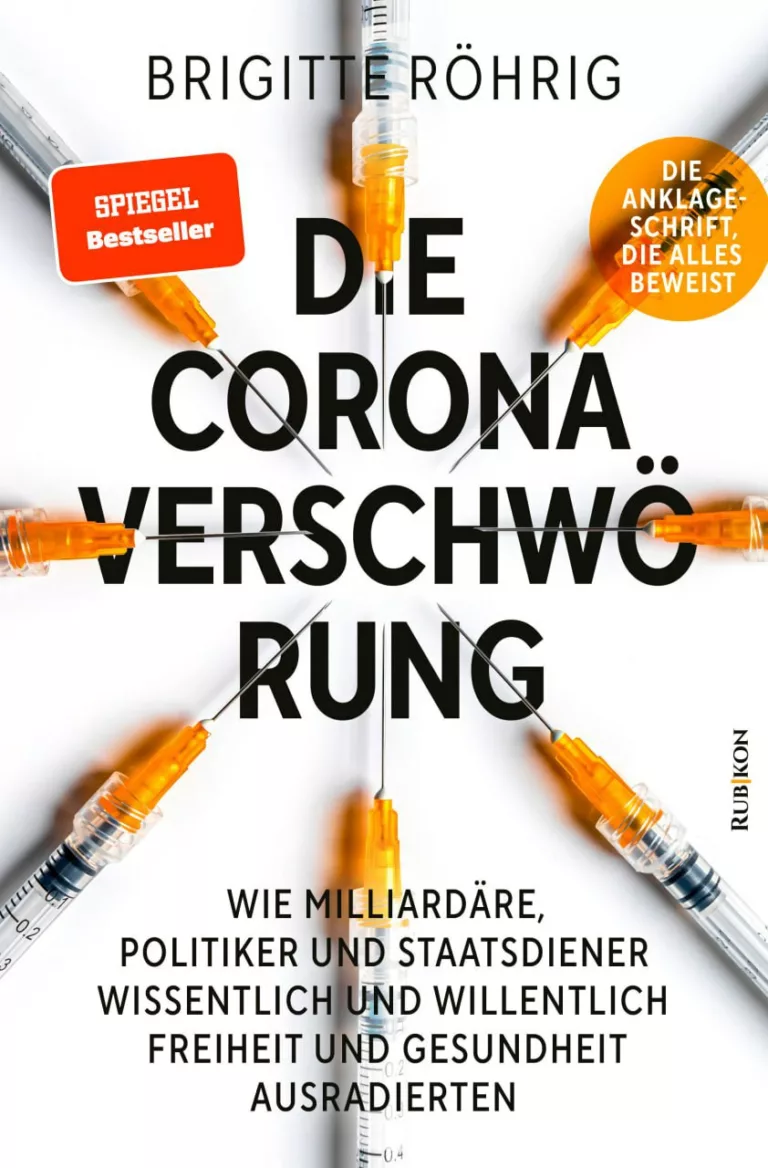




25 Antworten
Ein Hohelied auf Jugoslawien. Bravo. Das Land, die Utopie war eine Gefahr für die EU. Daher wurde es zerstört. In Bulgarien war für uns Jugoslawien immer ein Traumland. Bis die EU kam und „unsere Schwester Jugoslawien“ misshandelte und zerstörte. Als Jugendliche träumte ich davon nach Belgrad oder Sarajevo zu gehen und dort zu studieren. Das war vor dem Mauerfall…
Stimmt, kann ich bestätigen Bin oft auf dem Balkan unterwegs…
Ein netter Artikel, aber vollkommen unkritisch. Einerseits wären mehr Infos zu den Schattenseiten interessant, die es sicher auch in Yugoslavien gab, andererseits hätten mich mehr Hintergrundinfos dazu interessiert, wie dieser Staat überhaupt entstand. Ich weiß nur, dass gegen Ende des zweiten Weltkriegs zwar die Partisanen mit Tito von den Alliierten unterstützt wurden, z.B. mit Waffenlieferungen, die königstreuen Serben allerdings nicht, obwohl beide Seiten gegen das Nationalsozialistische Deutschland gekämpft haben. Vieles deutet darauf hin, dass Tito und Yugoslavien so wie wir es kannten von den Alliierten unterstützt und vielleicht sogar geplant war, später aber wie eine heisse Kartoffel fallen gelassen wurde, um es mal nett zu formulieren. Warum? Wäre vielleicht Stoff für einen dritten Teil?
Ich finde, der Artikel blickt positiv nach vorne. Kritik mussten wir Jugos doch schon zuviel ertragen, oder 😉
Die Themen, die du ansprichst sind spannend. Darüber reicht aber ein Buch offenbar nicht mal aus. Živela Jugoslavija… Ich jedenfalls bin und bleibe ein Jugo-Nostalgiker, jetzt erst recht und für immer 🙂
Walter brani Sarajevo?
Dem stimme ich absolut zu! Genau hier liegt der Schlüssel: Tito und die Entstehung Jugoslawiens wurden maßgeblich von den Alliierten gefördert, während andere antinationalsozialistische Kräfte kaum berücksichtigt wurden. Dass Tito später von eben jenen Mächten fallen gelassen wurde, verdeutlicht, wie komplex und widersprüchlich diese Geschichte ist. Definitiv Stoff für eine tiefere Analyse in einem möglichen dritten Teil. Gerade solche Hintergrundinformationen könnten ein differenziertes Bild schaffen und auch die heutige Nostalgie besser einordnen helfen. Danke für diesen wertvollen Gedankenanstoß!
p.s. aus serbischer Sicht würde ich sagen, bitte aus der Geschichte lernen und sich nicht nochmal auf solche Experimente einlassen. Enge und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Ländern unbedingt, aber auch nicht mehr als das. Steht aber ohnehin nicht zur Debatte, man kann ja schon froh sein, wenn es einigermaßen friedlich bleibt, soviel wie gezündelt und provoziert wird.
Was meinst damit? Freundschaftliche Zusammenarbeit entwickelt sich immer weiter, zwangsläufig. Freund zündeln ja nicht, dass sind dann diejenigen, die was gegen die Freundschaft haben. Sieht man ja an Deutschland-Russland Freundschaft. Und Jugoslawien war ebenfalls eine Gefahr für viele in West und Ost. Ich finde es war kein Experiment. Es entstand aus den damaligen Umständen heraus und hätte funktionieren können, wenn von aussen nicht gezündelt worden wäre. Daraus jetzt zu schlussfolgern, man müsse sich abschotten und isolieren wäre fatal. Mal sehen was der Autor in Teil 2 bringt.
Jedenfall danke für diesen Artikel, es ist genau die richtige Zeit dafür über ein neues Jugoslawien, wie auch immer es aussehen mag, zu diskutieren…
Klar, es wurde von aussen gezündelt. Aber der Zusammenhalt in Titos Jugoslawien war auch zu schwach. Es hatten sich grade mal 1/3 als Jugoslawen definiert. Da hatte die Brandstifter leichte Hand. Sieht man ja in der Ukraine auch, die Brandstifter kommen dann als Feuerwehrleute danach und legen noch mehr Brandbeschleuniger. Fatal ist, dass Slaven gegen Slaven gegeneinander Krieg führen. Und wer freut sich und lacht sich ins Fäustchen?
Ein Staat, in dem sich nur ein Drittel tatsächlich als Jugoslawen verstanden hat, hatte es von vornherein schwer, den externen Manipulationen und Brandstiftungen standzuhalten. Die Tragödie liegt tatsächlich darin, dass slawische Völker gegeneinander ausgespielt wurden – mit fatalen Konsequenzen. Parallelen zur heutigen Ukraine sind offensichtlich: Auch dort profitieren letztlich diejenigen, die zuerst zündeln und dann vermeintlich löschen, tatsächlich aber nur weiteres Öl ins Feuer gießen. Wer zuletzt lacht, wissen wir beide. Ein trauriges Muster, das immer wiederkehrt…
Freundschaftliche Zusammenarbeit entwickelt sich also zwangsläufig weiter, sagst du? Ja, klar – so wie zwischen Deutschland und Russland, sehen wir ja gerade. Ironie off. Tja, Freundschaft hält, bis sie jemandem ein Dorn im Auge ist. Jugoslawien war tatsächlich ein störendes Beispiel – weder Ost noch West mochten eine starke, eigenständige Alternative. Abschotten wäre falsch, da stimme ich dir zu. Aber aufpassen und kritisch bleiben, wenn von außen jemand mit „Freundschaftsangeboten“ kommt, ist sicher nicht verkehrt.
Das Sharepic (Bastards of YU-topia Fahne) finde ich gelungen. Müsste man auf T-Shirts drucken. Wäre die Nutzung erlaubt?
Živela Jugoslavija! Gde su tih Jugosloveni? Pozdrav iz Slovenije ✊️
Vi Slovenci ste uvek bili najveći Jugosloveni🤩 Veliki pozdrav iz Madekonije druže Slovenac 🫡
Lijep pozdrav iz Zagreba druže Slovenac 💯✌️
Hej Sloveni, pozdrav iz Sarajevo 😃🤝
smrt fašizma sloboda narodu drugovi ✊️
Wie wäre es mit einer Balkan Föderation. Bulgarien hat die Nase voll von der EU. Grüße aus Sofia…
Ein starker und eindrucksvoll geschriebener Artikel, der ein sensibles Thema differenziert und lebendig behandelt. Die kulturelle Verbundenheit, die über Landesgrenzen hinweg weiterbesteht, wird überzeugend beschrieben. Allerdings fehlt mir eine etwas kritischere Auseinadersetzung mit Tito selbst: Jugoslawien hatte zweifellos seine positiven Seiten, doch darf man nicht vergessen, dass Tito bis zum Ende seines Lebens strikt an seiner Macht festhielt, politische Gegner und Dissidenten verfolgen ließ und dadurch auch Angst und Unterdrückung verbreitete. Ein differenzierter Blick auf seine autoritären Methoden, auch wenn sie nicht im Zentrum stehen müssen, wäre hilfreich, um der komplexen Realität gerecht zu werden. Vielleicht könnte ein zweiter Teil dies aufgreifen, um noch stärker zu reflektieren, warum die jugoslawische Idee scheiterte – und wie man aus dieser Erfahrung konstruktiv lernen könnte.
Sehr interessante Sichtweise kennengelernt, vielen dank
Sehr interessant. War alles vor meiner Zeit. Beide teile zeigen, warum die Eliten gesellschaftliche Spaltung betreiben. Utopien dürfen nur unter dem Dach des WEF verwirklicht werden.
Könnte durchaus real werden. Es fehlt noch ein Funke. Gabs schon oft auf dem Balkan. Wer mehr erfahren will, wie Spaltung gerade in Krisenzeiten überwunden wird: https://derfunke.at/24689-selbstbestimmung-fuer-das-kosovarische-volk-fuer-die-sozialistische-balkanfoederation
Habs beim stöbern gefunden zum Thema. Lesen ohne ideologische Verblendung ist angebracht 😉
Die beiden Artikel kommen einer Studie gleich. Ja eine Utopie, in dieser Zeit des westlichen Untergangs könnte sie schneller real werden als einige denken. In welcher abgewandelten Form auch immer. Fico, Orban, Vucic u.a. könnten treibende Kräfte werden. Alle Achtung an den mir bisher unbekannten Autor
Utopien, wenn sie umgesetzt werden sind wie Sprengstoff. Deutschland geht wieder einmal dem selbstverschuldeten Untergang entgegen, was die Überwindung der Spaltung auf dem Balkan zugute kommen wird. Allerdings ist nicht zu unterschätzen, wie die Leien EU gegen Serbien vorgeht. Schon Open Balkan (kleines Schengen zwischen Serbien, Mazedonien und Albanien) ist der EU ein Dorn im Auge.
Der Zerfall ist nicht aufzuhalten