»Ein Fall von Ermittlungen gegen 17 Beamte« könnte eine Zäsur sein, also ein tiefer, bisher nie dagewesener Einschnitt. Denn selten zuvor wurde so offen sichtbar, was viele Betroffene seit Jahren berichten: dass aus staatlicher Schutzmacht, konkret der Polizei, eine Gefahr werden kann, wenn Kontrolle versagt, Loyalität wichtiger wird als Recht und Gesetz und Gewalt von jenen ausgeht, die sie eigentlich verhindern sollen.
Die Frankfurter Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt haben in einer groß angelegten Aktion 17 Polizeibeamte im Dienst, auch in Führungspositionen, durchsuchen lassen. Vier Dienststellen, 21 Privatwohnungen, 150 Einsatzkräfte – ein Aufwand, der die Schwere der Vorwürfe widerspiegelt. Die Rede ist von Körperverletzung im Amt, Strafvereitelung und der Verfolgung Unschuldiger. Zwischen Februar und April 2025 sollen Beamte sechs Männern während oder nach deren Festnahmen „unberechtigt körperlichen Schaden“ zugefügt haben. Eine Formulierung, die in ihrer bürokratischen Nüchternheit zynisch wirkt.
Denn „unberechtigter körperlicher Schaden“ klingt nach einem kleinen Unfall, einem Missverständnis, einem Ausrutscher im Dienst, als hätte sich ein Cop an einem Donut verschluckt. Tatsächlich aber geht es um nackte Gewalt. In einem Fall wurde ein Festgenommener eine Treppe hinuntergestoßen. Die Tatsache, dass der Staat solche Gewalt mit der Sprache eines Verwaltungsaktes umkleidet, ist eine zweite Demütigung, die Opfer von Polizeigewalt oftmals noch schwerer trifft als die Verletzungen selbst.
Gewalt wird vertuscht, Opfer werden zu Tätern
Ich erinnere mich an einen Fall, den ich als Prozessbeobachter vor Gericht verfolgt habe. Zwei Polizisten standen damals vor den Richtern und Schöffen, doch nicht etwa, weil sie einen Mann schwer misshandelt hatten, sondern weil sie ihn, da sich die Person gewehrt hatte, ihrerseits angezeigt hatten. Sie sagten aus, ruhig, präzise, perfekt aufeinander abgestimmt. Es war offenkundig, dass sie ihre Aussagen zuvor abgesprochen hatten. Am Ende wurde der Mann, der misshandelt worden war, wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verurteilt. Dabei hatte er sich in Todesangst gewehrt.
Bemerkenswert an dem aktuellen Fall ist, dass die Staatsanwaltschaft auch wegen Verfolgung Unschuldiger ermittelt – § 344 Strafgesetzbuch. Diesen Paragrafen kennt kaum jemand außerhalb der Juristenzunft. Er bestraft Amtsträger, die wider besseres Wissen ein Strafverfahren gegen einen Unschuldigen einleiten oder fortführen. Ein erfahrener Strafverteidiger sagte mir einmal, dass dieser Tatbestand in der Praxis so gut wie nie angewendet wird. Dass er aber nun zur Sprache kommt, könnte tatsächlich eine juristische Zäsur sein. Vielleicht bricht hier etwas auf, was zu lange unter der Oberfläche verborgen blieb.
Denn was sich hinter diesen Vorwürfen verbirgt, ist mehr als individuelles Fehlverhalten. Es ist Ausdruck einer Polizei-Omertà – jener ungeschriebenen Regel, dass man sich gegenseitig deckt, koste es, was es wolle. Der Begriff stammt aus der Welt der Mafia und meint das Schweigegelübde, das selbst Unrecht schützt, solange es von „eigenen Leuten“ begangen wird. Natürlich: Die überwältigende Mehrheit der Polizisten in Deutschland handelt rechtmäßig und professionell. Aber dort, wo Gewalt in den eigenen Reihen vertuscht wird, wo Akten verschwinden oder Anzeigen gar nicht erst aufgenommen werden, ist dieses Schweigen tödlich – für das Vertrauen, für den Rechtsstaat, für die Opfer.
Am Ende verliert der Rechtsstaat, also wir alle
Frankfurts Polizeipräsident Stefan Müller sprach von »„gravierenden Vorwürfen“, die zu Lasten „aller rechtmäßig handelnden Beamten gehen“«. Das stimmt – aber es geht noch tiefer. Denn die wahren Opfer sind zunächst die Menschen, die diese Gewalt erlitten haben. Das zweite Opfer allerdings ist der Rechtsstaat selbst, der in dem Moment Schaden nimmt, in dem diejenigen, die angestellt sind, um ihn zu schützen, zu Tätern werden.
Es wäre naiv zu glauben, dass diese Fälle nur in Frankfurt vorkommen. Wer mit Verteidigern, Richtern oder Journalisten spricht, hört immer wieder ähnliche Geschichten – von überzogener Gewalt, von erfundenen Widerstandshandlungen, von Dienstberichten, die so synchronisiert wirken, als seien sie mit demselben Finger geschrieben. Manchmal fällt ein Beamter auf, manchmal ein ganzes Revier. Doch fast immer bleibt das System unbeschädigt. Es schützt sich selbst.
Wenn der Innenminister Hessens, Roman Poseck, nun die Revierleitung austauscht, ist das ein notwendiges Signal – aber kein ausreichendes. Denn Strukturen ändern sich nicht durch Personalrotation, sondern durch eine Kultur der Verantwortung. Eine Polizei, die in Extremsituationen Macht ausüben darf, muss sich auch in Extremsituationen selbst kontrollieren lassen. Sie braucht Transparenz, nicht Loyalität um jeden Preis. Sie braucht Beamte, die wissen, dass ihre Uniform keine Narrenfreiheit für Gewaltfantasien bedeutet, sondern Verpflichtung – auf das Recht, nicht auf den vermaledeiten Korpsgeist.
Vielleicht, ja vielleicht ist dieser Fall die letzte Chance, das Thema unverhältnismäßige Polizeigewalt endlich breiter zu diskutieren. Denn am Ende sind die ersten Opfer jene, die geprügelt werden. Aber die zweiten Opfer sind wir alle – Bürger eines Staates, der seine moralische Autorität verliert, wenn Gewalt nicht mehr geahndet, sondern gedeckt wird. Wenn das in Frankfurt der Anfang eines neuen Bewusstseins ist, dann wäre dies eine heilsame Zäsur. Denn noch haben nicht alle kritischen Bürger das Vertrauen in den Rechtsstaat vollends aufgegeben.

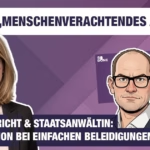









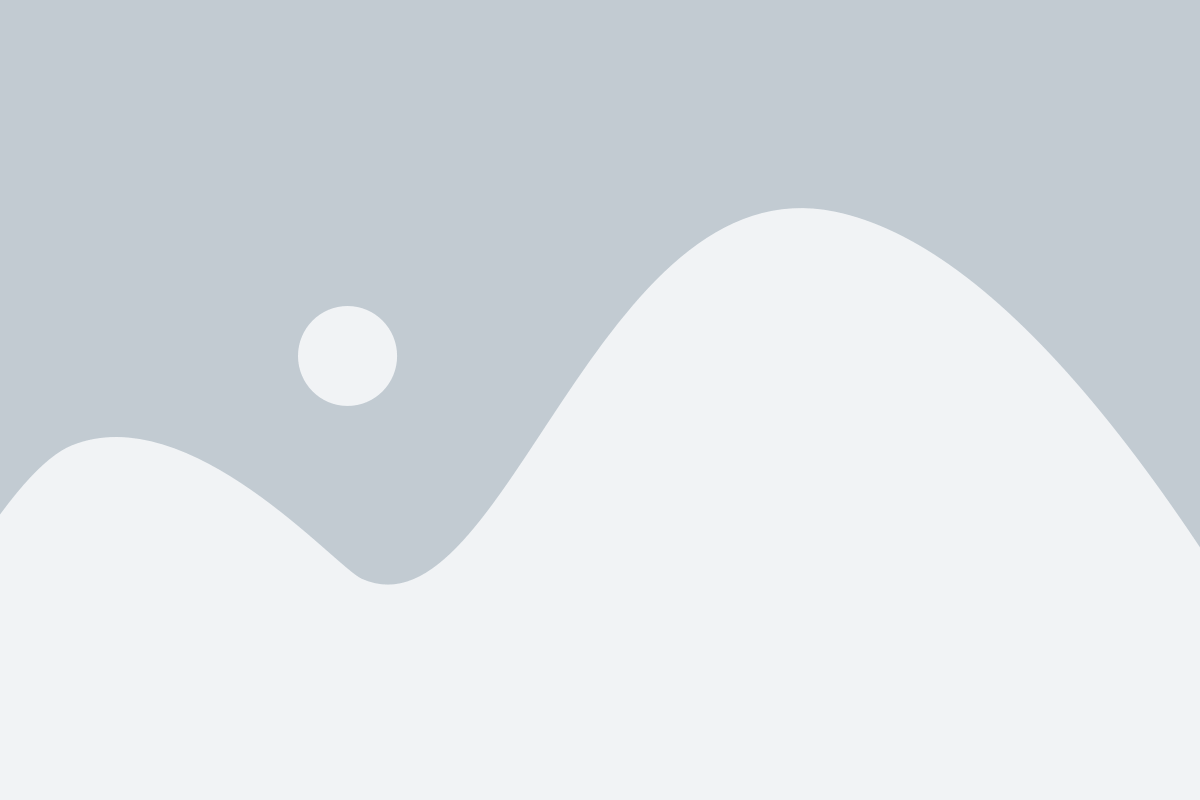


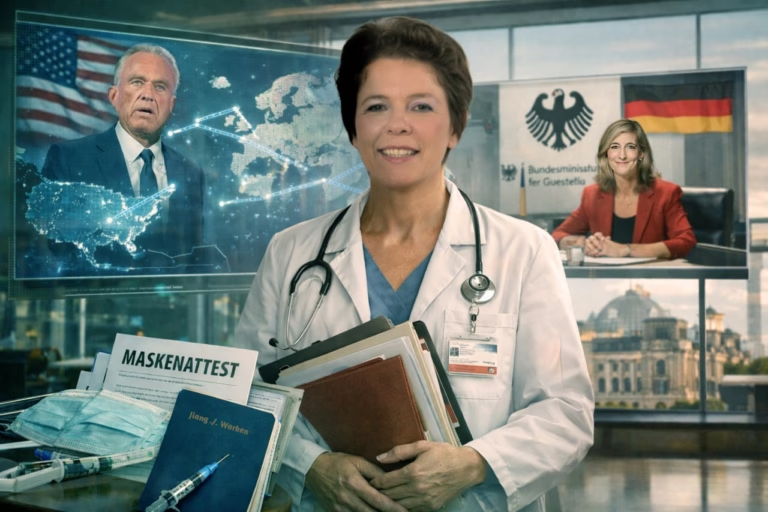




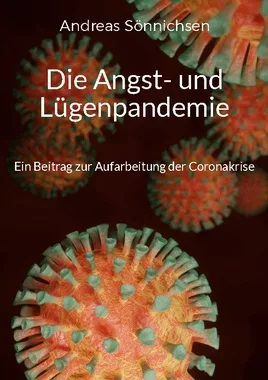




3 Antworten
Warum werden keine Einzelheiten benannt. Prügelende Polizisten kennt man ja von jeder Corona Demo
Ja die Ignozanz und das Schweigen kenn ich gut vor allem beim brutalen Vorgehen der Einheiten gegen die Montagsdpaziergänger in Wandlitz bei dem mein Mann ums Leben kam!
Schweigen, schweigen aussitzen ignorieren. Und sie kommen damit durch, weil sie von der Justiz beschützt werden.
Mein Beileid.
Ja, die prügendden Polizisten kenne ich auch sehr gut. Seit dieser Zeit habe ich meine Achtung vor der Polizei verloren.