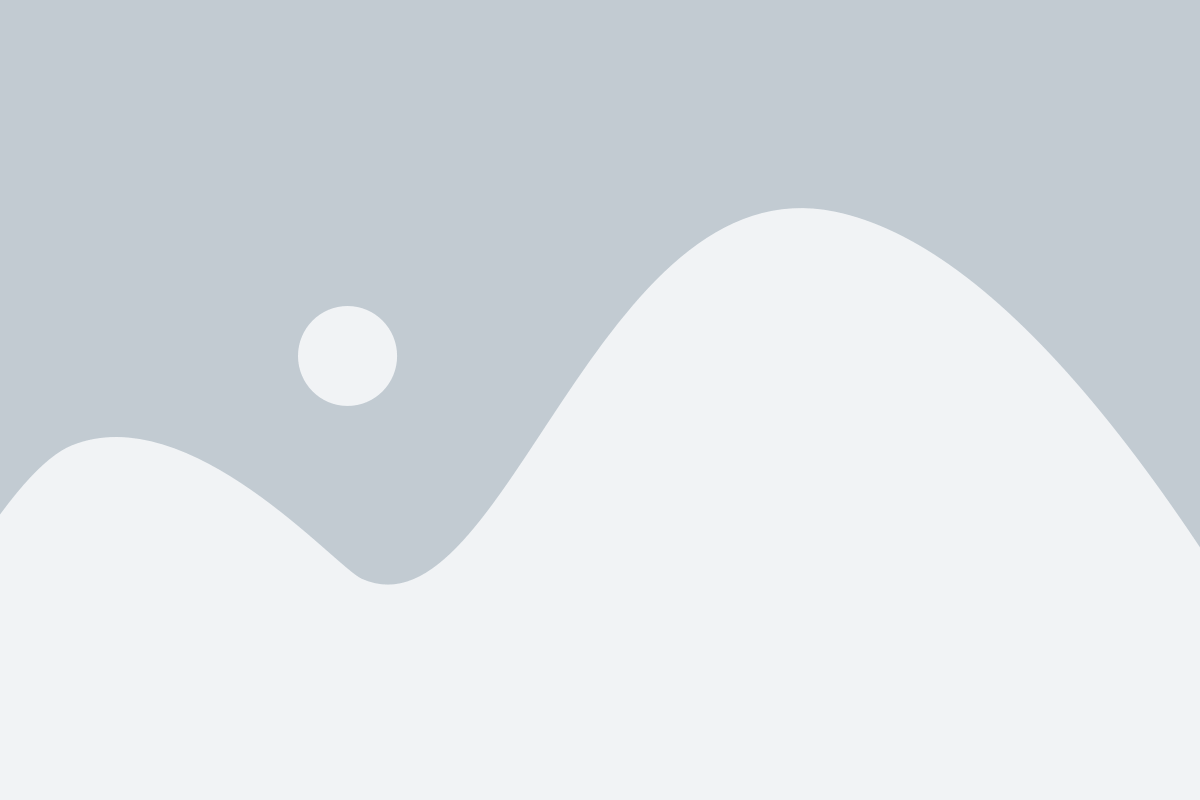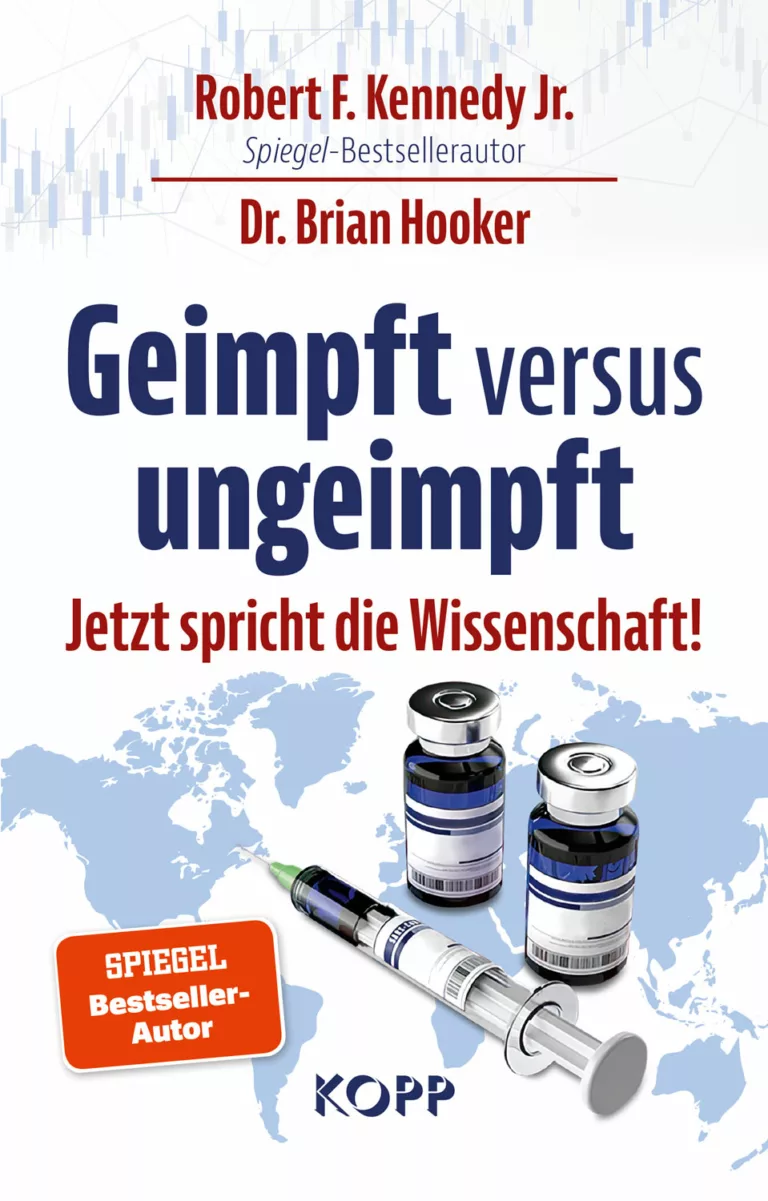Belgrad Sommer 2023: Novak Đjoković lässt sich in Wimbledon zum x-ten Mal feiern, während zeitgleich Nikola Jokić die NBA-Trophäe in die Höhe stemmt. Zwei Sport-Superstars aus demselben kleinen Land: Serbien. Solche Momente wirken fast schon surreal. Wie kann es sein, dass ein Staat mit nur sieben Millionen Einwohnern seit Jahren eine ganze Phalanx an Weltklasse-Athleten hervorbringt? Die Antwort liegt jenseits bloßer Aufzählungen von Medaillen. Sie führt tief in die Geschichte, Mentalität und Kultur eines Landes, das Sport nicht nur spielt, sondern lebt.
Rückblick, Melbourne, Januar 2022: Kurz vor dem Morgengrauen: In seinem kargen Zimmer im Park Hotel – einst ein Touristenquartier, nun zum Abschiebegewahrsam umfunktioniert – sitzt Novak Đoković auf der Kante eines schmalen Bettes. An der Decke flackert kaltweißes Neonlicht, während die Klimaanlage monoton brummt und matte Schatten an die blassen Wände malt. Durch das vergitterte Fenster dringt gedämpft der Lärm der Großstadt; irgendwo unten auf der Straße stehen Landsleute mit Kerzen in den Händen und singen leise serbische Lieder, als hielten sie Wache für ihren Helden. Noch vor wenigen Tagen sonnte sich Đoković im Rampenlicht des Centre Courts, jetzt umgibt ihn nur die graue Stille einer Haftnacht in der Fremde – festgehalten, weil er ungeimpft nach Australien eingereist war und sich weigerte, von seinen Überzeugungen abzuweichen. Sein Blick ist ruhig, doch in den dunklen Augen brennt ein stiller Trotz: Er könnte jederzeit in den nächsten Flieger steigen und diesem beengten Raum entkommen, aber für ihn steht mehr auf dem Spiel als ein Turnier. Hier geht es um Stolz und Prinzipientreue – auf dem Balkan hat diese unbeugsame Haltung einen Namen: Inat, jene stolze Mischung aus Prinzipientreue und trotzigem Eigensinn, die viele Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien auszeichnet – Serben, Kroaten, Bosnier, Mazedonier wie Montenegriner gleichermaßen. Đoković in Abschiebehaft, das ist mehr als die kuriose Episode eines Sportstars: Es ist das filmreife Bild eines Mannes, der um seiner Überzeugung willen lieber im stillen Käfig sitzt, als den eigenen Prinzipien untreu zu werden.
Von Krisen geformt: Sport als nationales Ventil
Serbiens Ausnahmestellung im Weltsport ist umso erstaunlicher, wenn man ihre jüngere Vergangenheit bedenkt. In den 1990er-Jahren zerfiel Jugoslawien in blutigen Konflikten, das Land litt unter Krieg, Sanktionen und Isolation. »Sport wurde in dieser Zeit zu einer Art Ventil« und zu einem stillen Motor des nationalen Inat, jenem serbischen Trotzgeist. »Inat« bedeutet so viel wie „stolze, trotzige Unbeirrbarkeit“, die hartnäckige Weigerung, sich geschlagen zu geben, gerade weil die Umstände widrig sind. Als die UN-Embargos das Land vom internationalen Sport abschnitten, schmiedeten die Athleten ihren Ehrgeiz im Verborgenen weiter. Kaum waren die Sanktionen vorbei, feierte die serbische (damals jugoslawische) Basketball-Nationalmannschaft ein furioses Comeback und gewann 1995 prompt »EM-Gold«. Es wirkte wie ein trotziges Lebenszeichen: Wir sind wieder da – und stärker als je zuvor.
Dieser trotzige Erfolgswille prägt bis heute die serbische Sportszene. Novak Đoković selbst, der aus Belgrad stammt und als Kind die NATO-Bombardements miterlebte, betont oft, dass die harte Zeit seiner Generation eine enorme mentale Stärke verliehen habe. „Wir mussten da durch in den 90ern – Krieg, Embargo, sehr schwierige Umstände zum Aufwachsen“, »reflektierte Đoković« einmal. Gerade diese Widrigkeiten hätten ihm und anderen Balkan-Sportlern eine unglaubliche Resilienz mitgegeben. Man kann es auch so sagen: Aus Schmerz wurde Stolz, aus Trotz Triumph.
Sport als Lebensgefühl und Tradition
Doch Serbiens Erfolgsrezept besteht nicht nur aus Trotz. Es gibt auch tiefe Wurzeln: Schon im sozialistischen Jugoslawien galt Sport als wichtige Säule der Gesellschaft. Talente wurden früh gefördert, Vereine wie Roter Stern und Partizan Belgrad bauten exzellente Jugendakademien auf. Diese Tradition lebt fort. So »erlernen Kinder« oft schon in der Schule die Grundlagen vieler Sportarten – vom Korbwurf bis zum Schmetterball. Sport ist in Serbien kein Luxus, sondern Lebensart. Ein gängiger Scherz besagt: »Jeder Serbe ist Nationaltrainer«, ob im Fußball, Basketball, Volleyball oder Wasserball. An jedem Kiosk wird über Aufstellungen und Taktiken diskutiert. Dieser volksnahe Sportenthusiasmus schafft eine breite Basis an Wissen und Leidenschaft.
Besonders Mannschaftssportarten haben im Land Tradition. Die goldenen Zeiten Jugoslawiens in Basketball, Wasserball oder Volleyball wirken nach. Nach dem Zerfall Jugoslawiens »machte Serbien quasi allein dort weiter«, wo einst ein Vielvölkerstaat dominierte. Im Wasserball etwa knüpften Serbiens „Delphine“ (Spitzname des Teams) nahtlos an: Europameister 2006, 2012, 2014, 2016, 2018, Weltmeister 2009 und 2015, Olympiasieger 2016. Und als Krönung verteidigten sie 2021 in Tokio sogar den Olympiatitel. Kaum ein anderes Land kommt an diese Bilanz heran. Ähnlich im Volleyball: Bereits im Jahr 2000 holte die Männer-Nationalmannschaft Olympiagold, und die serbischen Frauen wurden 2018 Weltmeisterinnen. Solche Triumphe sind nicht zufällig, sie sind Teil eines sportlichen Erbes, das von Generation zu Generation weitergegeben wird.
Novak Đoković, Sohn eines Kochs aus Belgrad, verkörpert diese Synthese aus Talent, Willen und Traditionsbewusstsein. Mit inzwischen 24 Grand-Slam-Titeln ist er nicht nur der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten, sondern auch ein Nationalheld. Đoković’ Aufstieg begann in bescheidenen Verhältnissen – in jugoslawischen Zeiten baute man Tennisplätze in ausgetrockneten Schwimmbecken – und führte ihn an die Spitze der Welt. Sein Erfolgsgeheimnis? Unbändiger Trainingsfleiß, eiserne mentale Stärke und ein Quäntchen Inat, wenn er gegen Widerstände kämpft. Er selbst sieht sich als »Botschafter Serbiens« auf der Weltbühne und weiß um seine Vorbildfunktion für junge Serben. Als Đoković 2010 mit dem Team den Davis Cup gewann, feierte Belgrad tagelang – Sport als Quelle kollektiven Stolzes und Identität.
Champions auf allen Bühnen – von Belgrad bis Denver
Neben Đoković hat Serbien in den letzten 25 Jahren eine ganze Riege an Weltstars hervorgebracht. Da ist zum Beispiel Ana Ivanović, die 2008 die Tennis-Weltrangliste anführte und in Paris triumphierte. Oder Jelena Janković, ebenfalls einst Nummer Eins der Welt. Bemerkenswert: Um 2010 stellten serbische Spielerinnen und Spieler gleichzeitig die Spitze sowohl im Herren- als auch Damensport. Und während im Tennis die Einzelkämpfer glänzen, brilliert Serbien auch im Kollektiv: Die Basketball-Nationalmannschaft heimste seit 1995 mehrere Europa- und WM-Titel ein und erreichte zuletzt Silbermedaillen bei Olympia 2016 und der WM 2014 – immer nur geschlagen vom übermächtigen Team USA.
Aus dieser Tradition erwuchs Nikola Jokić, heute der vielleicht beste Basketballer der Welt. Jokić stammt aus Sombor, einer Kleinstadt, und wuchs wie so viele serbische Jungs mit Körben und Bällen auf staubigen Hinterhöfen auf. Inzwischen verzaubert der 2,11 m-Hüne die NBA. Zweimal in Folge wurde er MVP (most valuable player, wertvollster Spieler) der NBA, führte seine Denver Nuggets 2023 zur Meisterschaft. Dass ausgerechnet ein gemütlich wirkender Serbe namens „Joker“ die glamouröse US-Liga dominiert, entlockt vielen ein Schmunzeln – und doch nimmt man es ehrfürchtig zur Kenntnis. Đoković lobt Jokić als „unglaublich intelligenten Basketballspieler“ und wahren Serbien-Botschafter. Umgekehrt schwärmt Jokić von Đoković’ Vorbildwirkung. Beide zeigten im Sommer 2023 gemeinsam, was ihr Heimatland leisten kann: Der eine triumphierte in Paris bei den French Open, der andere gleichzeitig in der NBA – ein serbische Doppelerfolg, der selbst verwöhnte Sportfans staunen ließ.
Nikola Jokić verkörpert auch einen gewissen Kontrast zu Đoković in der serbischen Sport-DNA: Während Đoković als Einzelkämpfer die Einsamkeit des Tenniscourts meistert, glänzt Jokić im Mannschaftsgefüge. Doch beide Wege führen zum Gipfel – vielleicht, weil in Serbien sowohl individuelle Improvisationskunst als auch Teamgeist von klein auf gefördert werden. Man ist es gewohnt, mit wenigen Mitteln viel zu erreichen. Serbiens Sportler gelten als robust, aber auch kreativ – eine Mischung, die international begeistert
Interessanterweise bleibt ausgerechnet der Fußball – global die beliebteste Sportart – Serbiens „Problemkind“. Trotz begnadeter Kicker (von Dejan Stanković bis Dušan Vlahović) blieben die ganz großen Erfolge aus; die Nationalelf wartet seit Jahrzehnten auf einen WM-Viertelfinaleinzug. Vielleicht ist es die Kehrseite des Inat: Man träumt im Fußball dem scheinbar Unerreichbaren nach, anstatt sich auf die tatsächlichen Stärken zu besinnen. Während also Basketballer und Volleyballer Medaillen sammeln, »trauert man dem runden Leder hinterher« – eine fast tragikomische Obsession, die in Serbien selbstironisch als „nationale Leidensliebe“ erkannt wird. Doch selbst das scheint sich zu wandeln: Immer mehr Fans erkennen, dass man im Basketball und anderen Sportarten Weltklasse ist, und feiern diese Erfolge nun genauso hingebungsvoll wie früher nur den ersehnten Fußball-Triumph.
Das Geheimnis? Mentalität, Ausbildung und ein Quäntchen Trotz
Serbien führt uns eindrucksvoll vor Augen, dass sportlicher Erfolg von Faktoren geprägt wird, die über Talent und Geld hinausgehen. Sicher, es gibt auch strukturelle Gründe: Die exzellenten Trainer-Schulen zum Beispiel. Namen wie Aleksandar Nikolić, Željko Obradović oder Veselin Vujović (im Handball) stehen für Trainerlegenden, die Wissen weitergaben und neue Generationen formten. Viele serbische Coaches sind weltweit gefragt – ein stiller Export von Know-how. Hinzu kommt die serbische Diaspora: Überall auf der Welt gibt es serbische Gemeinden, die ihren Athleten den Rücken stärken. Sei es Đoković, der bei den Australian Open dank tausender serbischer Exil-Fans quasi ein „Heimspiel“ hatte, oder Jokić, den Serben in den USA frenetisch feiern – der Erfolg der Sportler wird global geteilt. Die Diaspora hilft oft auch praktisch, etwa durch Stipendien für junge Talente im Ausland oder Beziehungen zu Vereinen. So überbrücken clevere Athleten manche Lücken in der heimischen Förderstruktur.
Und doch bleibt da dieses immaterielle Etwas, das Serbiens Sportwunder antreibt: Die mentale Komponente. Es ist der Mix aus Leidenschaft und Trotz, aus Stolz und Gemeinschaftsgefühl. Sport ist in Serbien mehr als nur Freizeit – er ist eine Bühne, auf der ein kleines Land Größe zeigen kann. Wenn »westliche Beobachter« verwundert von „serbischen Sport-Genen“ sprechen, greifen sie zu kurz. Gene allein erklären nicht die schiere Breite der Erfolge – von Basketball über bis zu Volleyball und Wasserball. Eher schon ist es eine Kultur des Wettkampfs und der Improvisation, gewachsen in schweren Zeiten. „Wir lieben Sport; nein, wir lieben Sport wirklich“, zitiert die »Washington Post« einen serbischen Fan in Paris. Dieses Feuer lodert überall: Kinder spielen stundenlang draußen, auch wenn der Platz holprig ist; Vereine halten zusammen, auch wenn das Geld knapp ist; Athleten beißen sich durch, selbst wenn niemand an sie glaubt.
Am Ende entsteht so etwas wie eine sportliche Identität, die Serbien auszeichnet. Man könnte fast von einem „serbischen Sportwunder“ sprechen – doch im Land selbst zucken viele mit den Schultern. Für sie ist es kein Wunder, sondern das Ergebnis von harter Arbeit, Talent und unerschütterlichem Willen. Wenn Novak Đoković und Nikola Jokić heute als „Gipfel“ dieses Erfolgs wirken, dann ruht der Berg auf einem breiten Fundament: zahllosen Trainern, Familien, Fans und einem kulturellen Verständnis, das den Sport feiert und fordert zugleich. Serbien mag klein sein auf der Weltkarte – auf der »Landkarte des Sports« aber nimmt es einen weit größeren Platz ein, als die Größe vermuten ließe. Und während die Welt rätselt, wie dieses Land immer wieder Champions hervorbringt, schwingt in Belgrad leise ironisch der Gedanke mit: Vielleicht liegt ja doch etwas im serbischen Wasser – oder eben im Herzen der Menschen, die nie aufhören werden, an Erfolge „aus Prinzip“ zu glauben.
_____________________________________________________________________________________
Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht zwingend die Ansichten der Redaktion von HAINTZ.media wider. Rechte und inhaltliche Verantwortung liegen beim Autor.