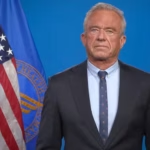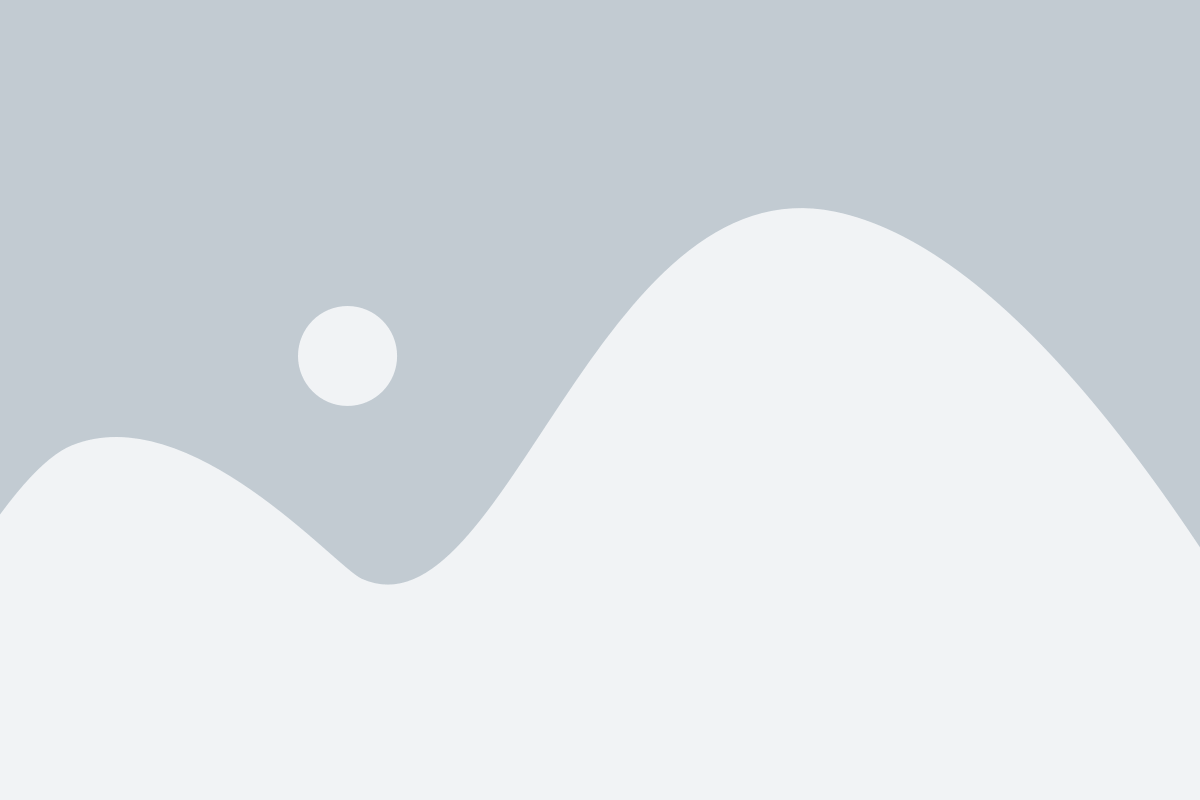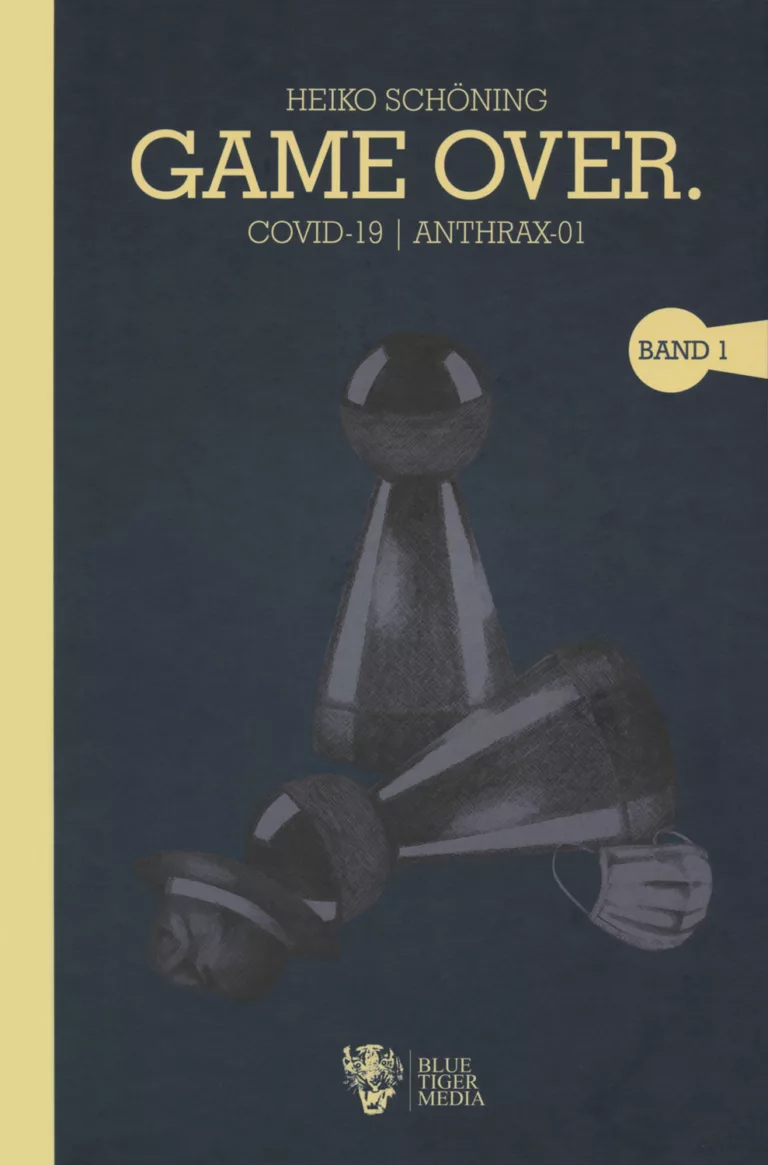Ein Kommentar von Prof. Dr. Martin Schwab:
„Liebe Community,
Mit Urteil vom 9.10.2025 – 3 C 5.24 hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass jemand, der nach positivem Corona-Test in Quarantäne gesetzt wird und daher seiner Arbeit nicht nachgehen kann, seinen Verdienstausfall nicht nach § 56 Abs. 1 IfSG ersetzt bekommt. Bisher ist nur eine »Pressemitteilung«, nicht aber der Volltext des Urteils verfügbar.
Das BVerwG stützt sich maßgeblich auf § 56 Abs. 1 Satz 4 IfSG. Darin ist, soweit hier von Interesse, Folgendes bestimmt:
„Eine Entschädigung (…) erhält nicht, wer durch Inanspruchnahme einer Schutzimpfung (…) eine Absonderung hätte vermeiden können.“
Die Vorinstanzen hatten dem Kläger – einem selbständigen Unternehmer, der im Oktober 2021 positiv auf SARS CoV-2 getestet worden und daraufhin in Quarantäne gesetzt worden war – einen Entschädigungsanspruch zugesprochen, weil sie den § 56 Abs. 1 Satz 4 IfSG eng auslegten: Ausgeschlossen sei der Entschädigungsanspruch nach dieser Vorschrift nur, wenn eine höhe Wahrscheinlichkeit bestehe, dass die Ansteckung (und damit die Absonderung) durch die Impfung vermieden worden wäre. Und eine derart hohe Wahrscheinlichkeit hatten die Vorinstanzen nicht festzustellen vermocht. Dem ist das BVerwG nicht gefolgt: Der Anspruch entfalle vielmehr schon dann, wenn die bloße Möglichkeit bestehe, dass der Kläger sich mit einer Impfung nicht mit SARS CoV-2 infiziert hätte.
Vom Wortlaut des § 56 Abs 1 Satz 4 IfSG ist die vom BVerwG bevorzugte Deutung gedeckt: Dort steht nicht „… vermieden hätte“, sondern „… hätte vermeiden können“. Zwingend ist diese Deutung indes nicht; vom Wortlaut her wäre auch die für den Kläger günstigere Interpretation der Vorschrift durch die Vorinstanzen vertretbar gewesen. Und in der Tat fordert das Urteil des BVerwG Kritik heraus.
Im Oktober 2021 verfügten sämtliche in der EU zugelassenen COVID-Injektionen lediglich über eine bedingte Zulassung. Die klinischen Studien zu Sicherheit und Wirksamkeit der Substanzen waren damals noch nicht abgeschlossen (und sind es übrigens bis heute nicht). Die veröffentlichten Zulassungsstudien (z.B. für BioNTech: Polack et al., Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine, New England Journal of Medicine 2020;383:2603-15; für Moderna: Baden et al., Efficacy and Safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine, New England Journal of Medicine 2021;384:403-16) spiegelten lediglich Zwischenergebnisse.
Die Ungewissheit über die Wirksamkeit der Injektionen war bei den Herstellern bekannt. Noch im Jahr 2022 gab BioNTech in seinem Bericht an die US-Börsenaufsicht Folgendes bekannt:
„Die von uns entwickelten Produktkandidaten könnten nicht oder nur mäßig wirksam sein (…).
[Und im Jahr 2023]:
„Es könnte sein, dass wir nicht in der Lage sind, eine ausreichende Wirksamkeit oder Sicherheit unseres COVID-19-Impfstoffs nachzuweisen, um eine dauerhafte Zulassung in Ländern zu erhalten, in denen er für den Notfalleinsatz zugelassen ist oder eine bedingte Marktzulassung erhalten hat.“
»Die Börse darf man nicht anlügen / DrBine´s Newsletter«
Also: Die Hersteller wussten im Oktober 2021 nicht, ob die Impfung überhaupt wirkt. Konsequent wusste es auch die EMA als Zulassungsbehörde nicht. Dann aber verbietet sich im Kontext des § 56 Abs. 1 Satz 4 IfSG bereits im Ansatz die Hypothese, jemand, der sich mit COVID-19 infiziert hat, hätte die Ansteckung und damit die Quarantäne vermeiden können.
Hinzu kommt, dass der Kläger im Streitfall zwar positiv getestet, aber noch nicht zwingend infiziert war. Die für eine Infektion (§ 2 Nr. 2 IfSG) charakteristische Vermehrung des Erregers kann ein PCR-Test nämlich nicht nachweisen. Im Epidemiologischen Bulletin des RKI Nr. 39/2020 lesen wir auf Seite 5, rechte Spalte unten:
„Im Gegensatz zu replikationsfähigem Virus ist die RNA von SARS-CoV-2 bei vielen Patienten noch Wochen nach Symptombeginn mittels PCR-Untersuchung nachweisbar. Dass diese positiven PCR-Ergebnisse bei genesenen Patienten nicht mit Ansteckungsfähigkeit gleichzusetzen ist, wurde in mehreren Analysen gezeigt, bei denen parallel zur PCR-Untersuchung eine Anzucht von SARS-CoV-2 in der Zellkultur durchgeführt wurde“.
»Epidemiologisches Bullletin 39/2020 / RKI«
Juristisch bedeutet dies: Ein positiver PCR-Test zeigt keine Infektion i. S. des § 2 Nr. 2 IfSG an, sondern allenfalls einen Ansteckungsverdacht i. S. des § 2 Nr. 7 IfSG. Dies hat erhebliche Auswirkungen für die Handhabung des § 56 Abs. 1 Satz 4 IfSG. Wenn nämlich der Wortlaut dieser Vorschrift nicht eindeutig ist, muss der Rechtsanwender das Regelungsziel dieser Vorschrift heranziehen, um der richtigen Auslegung näherzukommen.
Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages deutet § 56 IfSG als Billigkeitsentscheidung des Gesetzgebers. Denn wenn von einem Menschen eine Gefahr ausgehe, müsse dieser die Maßnahmen zur Gefahrbekämpfung, hier: die Quarantäne, entschädigungslos hinnehmen. Wäre diese Deutung richtig, würde dies für die vom BVerwG bevorzugte Handhabung des § 56 Abs. 1 Satz 4 IfSG sprechen: Dann könnte man dem Betroffenen tatsächlich entgegenhalten, er habe, bevor er eine Entschädigung verlange, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um zu vermeiden, dass er sich überhaupt ansteckt.
Aber diese Argumentation trägt nicht, wenn jemand nicht nachweisbar ansteckungsfähig infiziert, sondern nur ansteckungsverdächtig ist. Dann weiß man eben gerade nicht, ob von ihm eine Gefahr ausgeht. Was das Gesundheitsamt hätte tun müssen, um den Ansteckungsverdacht zur Gewissheit zu erhärten, haben wir im Epidemiologischen Bulletin Nr. 39/2020 lesen können: Es muss versucht werden, aus den Abstrichproben vermehrungsfähiges Virus anzuzüchten.
Solange aber der Staat sich nicht die Mühe macht, den festgestellten Ansteckungsverdacht zu erhärten, muss zugunsten des Bürgers, der in Quarantäne gesetzt wurde, unterstellt werden, dass von ihm KEINE Gefahr ausging. Der Betroffene hat, indem er in Quarantäne gesetzt wurde, ein Sonderopfer erbringen müssen, für das er zwingend zu entschädigen ist (sog. Aufopferungsanspruch). Diesen Anspruch kann man ihm gerade nicht unter Hinweis darauf wieder nehmen, er hätte die Quarantäne ja vielleicht (!) verhindern können.
Insgesamt verdient das Urteil des BVerwG keine Zustimmung. Das BVerwG hätte die Klage nicht abweisen dürfen, sondern das Urteil der Vorinstanz bestätigen müssen.
Herzliche Grüße
Ihr und Euer
Martin Schwab“