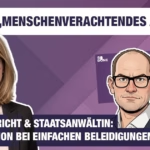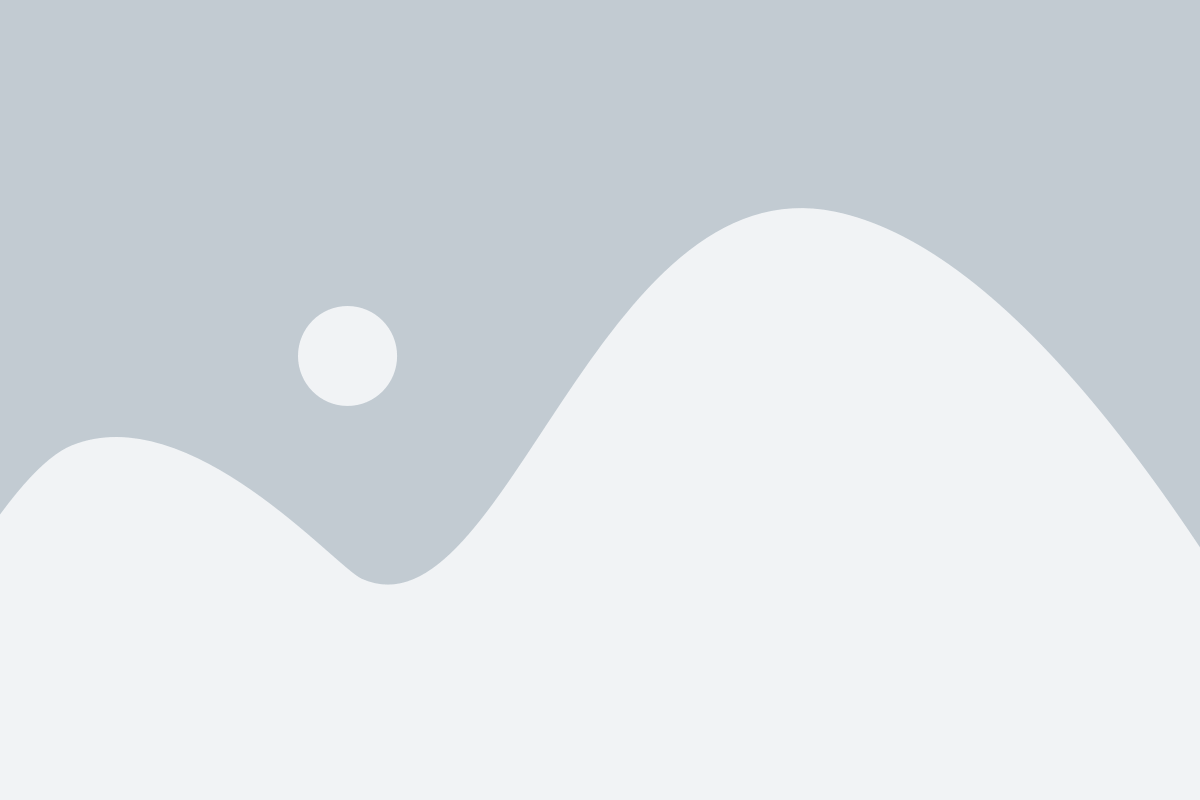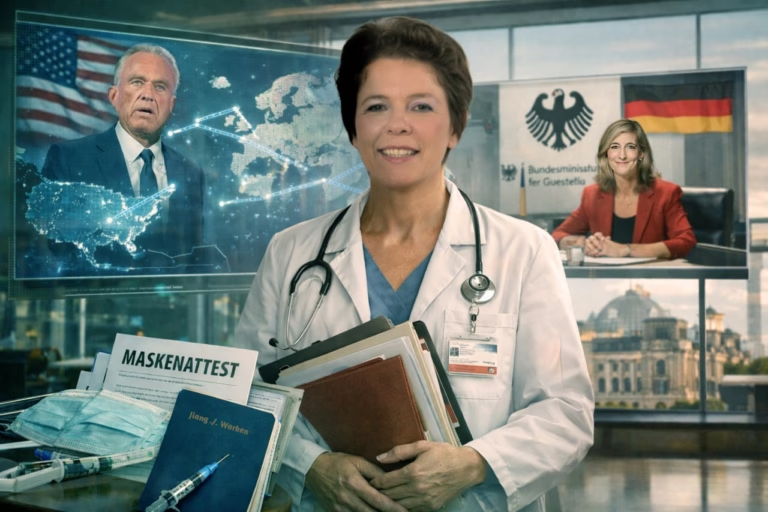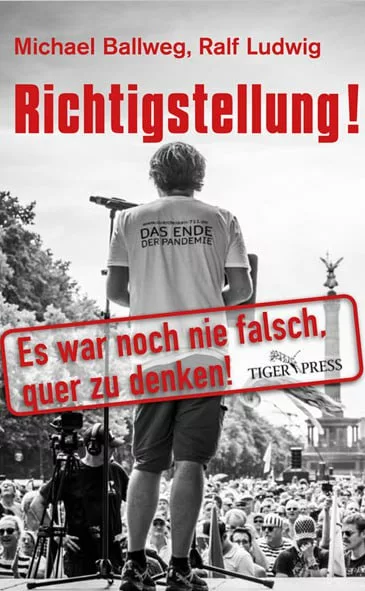Seit 2020 folgt eine Krise der nächsten. Pandemie, Krieg, Inflation, Energiepreise, Klima, Angst vor Blackouts, zuletzt vor russischen Drohnen. Kaum eine Woche vergeht, ohne dass neue Bedrohungsszenarien die Schlagzeilen dominieren. Kein Ereignis allein überfordert, doch die Summe der Krisen wirkt wie ein permanenter Ausnahmezustand.
Der jüngste Fall war Anfang Oktober. Deutsche Medien meldeten einen Drohnenalarm über einem NATO Stützpunkt bei Aachen. Die Polizei rückte aus, NATO Sprecher warnten. Wenig später folgte die Entwarnung. „Es ist alles unverdächtig“ hieß es. Kein Flugobjekt, kein Angriff, kein Risiko. Doch die Schlagzeile blieb im Gedächtnis und Kanzler Merz nutzt die Alarmierung, um die Kriegsgefahr noch einmal mehr zu betonen: „Wir sind nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht mehr im Frieden.“
Der Journalist Henning Rosenbusch kommentiert eine ORF Sendung über angebliche Drohnensichtungen in NRW mit den Worten:
„Sie weiß so gut wie nichts, aber die Situation ist ernst. Eine Expertin. Pardon, Drohnen-Expertin. Der Blick. Der Ton. Ich habe gerade ein unangenehmes Déjà-vu.“
(Quelle: ORF Video via Rosenbusch)
Das Déjà-vu ist berechtigt. Die Mechanik ist dieselbe wie in der sog. Pandemie. Angst ersetzt Aufklärung.
Die Mechanik der Angst
Während der Corona-Jahre wurde sichtbar, wie eng Politik, Wissenschaft und Medien miteinander verflochten sind, wenn es darum geht, Krisen zu kommunizieren. Der Forscher Bastian Barucker beschreibt im Buch „Vereinnahmte Wissenschaft“ den inneren Zustand des Robert Koch-Instituts als „Zwickmühle“ zwischen politischer Weisung und wissenschaftlicher Redlichkeit.
„Das RKI ließ sich Stück für Stück vereinnahmen, bis zur Mitwirkung an einer allgemeinen Impfpflicht. Problematisch ist, dass der Bevölkerung vorgetäuscht wurde, die Politik höre auf die Wissenschaft.“
Eine Passage aus den RKI-Protokollen spricht Bände:
„Eine Herabstufung des Risikos würde möglicherweise als Deeskalationssignal interpretiert, daher politisch nicht gewünscht.“
Nachdenkseiten: Neues Buch zur Corona-Aufarbeitung: Testen, testen, testen – für die Politik!
Mit anderen Worten, Beruhigung war nicht erwünscht.
Barucker sieht darin das zentrale Muster unserer Zeit. Durch „Angsterzeugung und Gruppendruck“ sei Konformität geschaffen worden. Kritik galt als Gefahr, das Prinzip „Follow the Science“ wurde ersetzt durch „Follow the Line“.
Vom Virus zur Drohne
Nach dem Ende der sog. Pandemie verschwand die Rhetorik nicht. Sie verlagerte sich. Seit Februar 2022 wird die Angst vor Krieg, vor Angriffen, vor Eskalation stetig genährt. Mal sind es russische Hacker, dann Drohnen, dann Gasleitungen. Jede Entwarnung kommt zu spät. Der Reflex, Bedrohung zu kommunizieren, bleibt stärker als der Wille zur Differenzierung.
Das Publikum hat gelernt, in Alarmfarben zu denken und genau das erschöpft.
Der Erschöpfungsdruck
Die kumulative Wirkung anhaltender Krisen wirkt wie ein psychologisches Dauerfeuer. Sie erzeugt in vielen Menschen ein Gefühl ständiger Alarmbereitschaft. Differenzierung fällt schwer, Erholung bleibt Illusion.
Die Flucht erfolgt oft in Rückzug, neue Lebensmodelle, Spiritualität oder Selbstständigkeit. Doch selbst diese Auswege bleiben nicht frei von gesellschaftlichen Kräften und Erwartungen.
Der Psychiater Hans-Joachim Maaz beschreibt dieses Phänomen als „falsches Leben“. Eine Gesellschaft, die Menschen in permanenter Anpassung und Angst hält, erzeugt psychische Störungen in Serie. Maaz nennt das Normopathie, die krankhafte Anpassung an ein krankes System. Was alle tun, kann nicht falsch sein, lautet der innere Leitsatz dieser Haltung.
Normopathie, so Maaz, ist der Boden, auf dem Konformität, Spaltung und schließlich auch Gewalt gedeihen. Eine Gesellschaft, die Gefühle verdrängt und Angst kultiviert, verliert die Fähigkeit zu Empathie und Selbstwahrnehmung. So entsteht kollektive Erschöpfung, die als Normalität gilt.
Empathie bedeutet, das Gegenüber wirklich wahrzunehmen, nicht nur rational, sondern emotional. Sie ist das einzige Mittel, das einer Kriegsökonomie etwas entgegensetzen kann, denn wer Mitgefühl empfindet, kann Leid nicht gleichgültig hinnehmen. Eine empathische Gesellschaft wäre die Antithese zur Angstgesellschaft, weil sie Verbindung statt Feindbilder schafft.
Der Ausweg liegt, so Maaz, in einer Rückkehr zu Gefühlsfähigkeit und Beziehungskultur, in der bewussten Entscheidung, sich dem Dauerstress und den Angststrukturen zu entziehen. Wer innerlich frei bleiben will, muss lernen, sich von der ständigen Krisenlogik zu lösen.
(Quelle: Hans-Joachim Maaz, Das falsche Leben, 2023)
Fazit
Vielleicht beginnt Heilung genau dort, wo Angst ihre Wirkung verliert.
Nicht in neuen Parolen oder Konzepten, sondern im Wiedererlernen des eigenen Empfindens. Wer sich der Daueraufregung entzieht, erkennt, wie viel Stille noch möglich ist und dass Widerstand manchmal schlicht bedeutet, innerlich nicht mehr mitzuspielen.
Eine Gesellschaft, die sich von Angst ernährt, bleibt beherrschbar. Eine, die wieder fühlt, wird unberechenbar und damit lebendig.