Über mehrere Jahre interpretierte ich für ein anderes Medium die monatlichen Arbeitslosenzahlen. Dabei fiel mir auf, dass zwischen den nüchternen Zahlen und ihrer Bewertung in der Langform des Berichts und den optimistisch gefärbten Pressemitteilungen eine Diskrepanz herrschte. Zahlen, die kaum Anlass zur Euphorie gaben, wurden in den Mitteilungen zu Erfolgsgeschichten umgedeutet. Dieses Muster zeigt sich nun auch beim IAB (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung), dem Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit, das jüngst eine Studie über die Erwerbsbeteiligung der 2015 nach Deutschland geflüchteten Menschen »veröffentlichte«.
Diese IAB-Studie sagt aus, dass 64 Prozent der vor zehn Jahren eingewanderten Flüchtlinge einer abhängigen Beschäftigung nachgehen, was laut den Statistikern nahe an der Beschäftigungsquote der Gesamtbevölkerung von 70 Prozent liege. Auffallend ist, dass Frauen mit einer Beschäftigungsquote von 35 Prozent deutlich weniger erwerbstätig sind als Männer (76 Prozent). Herbert Brücker, IAB-Forschungsbereichsleiter, betont selbstzufrieden: „Dies sei wegen der anfangs ungünstigen Ausgangsbedingungen keineswegs selbstverständlich.“ Diese Bekundung nötigte die »Tagesschau« zu der freundlich-geframten Meldung: „Die meisten Geflüchteten von 2015 haben einen Job.“
Methodische Mängel
Die erste Schwierigkeit ergibt sich in der Methodik. Das IAB erhebt seine Daten in einer Panelstudie, das heißt, dieselben Flüchtlinge werden über mehrere Jahre hinweg immer wieder befragt. Leider ist diese Art der Datenerhebung anfällig für Verzerrungen – vor allem für den sogenannten Selektionsbias (Verfälschung durch die Auswahl). Selektionsbias bedeutet, dass die Stichprobe nicht mehr repräsentativ für die Grundgesamtheit ist, weil bestimmte Gruppen eher teilnehmen und andere eher ausfallen. Ein einfaches Beispiel: Wenn ein Lehrer nur die Schüler befragt, die freiwillig nach dem Unterricht dableiben, wird er vermutlich bessere Ergebnisse bekommen – die schwächeren Schüler, die vielleicht keine Lust haben, sind dann gar nicht in der Statistik dabei. Genauso verhält es sich bei freiwilligen Befragungen: Wer erfolgreich ist, beteiligt sich eher. Wer scheitert oder frustriert ist, bricht tendenziell eher ab. Genau das verzerrt die Ergebnisse nach oben. Der IAB-Bericht bleibt an dieser Stelle vage, sodass unklar ist, wie viele Flüchtlinge über den gesamten Zeitraum hinweg überhaupt kontinuierlich befragt wurden.
Schlechte Bildung erschwert die Beschäftigung signifikant
Ganz anders verhält es sich beim Mikrozensus, der jährlich vom Statistischen Bundesamt durchgeführt wird. Hieraus dürfte sich die Beschäftigungsquote von rund 70 Prozent auf die Gesamtbevölkerungszahl ergeben, die der IAB-Bericht als Vergleich zieht. Bei der Erhebung des Mikrozensus werden rund ein Prozent aller Haushalte in Deutschland befragt, also mehrere hunderttausend Personen. Die Teilnahme ist verpflichtend, was die Verzerrung deutlich reduziert und die Ergebnisse belastbarer macht. Vor allem bei Fragen der Erwerbstätigkeit und Einkommen sind die Daten aus dem Mikrozensus daher zuverlässiger als jene aus Panelbefragungen. Wer die IAB-Ergebnisse also eins zu eins mit der Gesamtbevölkerung vergleicht, vergleicht Äpfel mit Birnen: unterschiedliche Erhebungsmethoden mit unterschiedlich hoher Repräsentativität. Pikant hierbei: »Laut dem IAB-Migrationsmonitor« ergibt sich eine Beschäftigungsquote von Menschen aus Asylstaaten von lediglich 46 Prozent. Währenddessen meldet jedoch das gleiche Institut im aktuellen Bericht, dass nun 64 Prozent derer, die 2015 nach Deutschland kamen, in Arbeit sind. Hier entsteht eine Lücke von 20 Prozentpunkten, was sich vor allem aufgrund der beschriebenen Problematik der freiwilligen Befragung ergibt. Weshalb die Tagesschau oder wenigstens das IAB selbst nicht auf diese offensichtliche methodische Fehleranfälligkeit hinweist, kann lediglich mit dem Willen, eine politische Färbung zu generieren, erklärt werden.
Dazu kommt die ungleiche Verteilung zwischen Männern und Frauen, die 2015 als Flüchtlinge ins Land kamen. Während bei den Männern deutlich höhere Quoten erreicht werden, liegt die Beschäftigungsquote von „geflüchteten“ Frauen bei nur rund 35 Prozent, d. h. nur etwa halb so hoch wie die in der Gesamtbevölkerung. Diese niedrige Quote liegt zum einen an der ungleich höheren Anzahl an Schwangerschaften und Kindern in dieser Gruppe, zum anderen am niedrigeren Bildungsstandard. Die Sprachbarriere kommt erschwerend dazu. Daher klingt die Aussage von Herrn Brücker, dass das „größte Potential bei geflüchteten Frauen“ liege, eher wie eine euphemistische Luftblase, als dass sie den vom Statistiker wohl gewollten Optimismus rechtfertigen kann.
Flüchtlinge leben um ein Vielfaches häufiger vom Staat
Noch frappierender sind die Unterschiede im Einkommen. Das IAB gibt an, dass der Medianverdienst von Geflüchteten bei etwa 2675 Euro liegt. Der Median bedeutet, dass die eine Hälfte der Gruppe mehr, die andere weniger verdient. Damit ist er aussagekräftiger als der arithmetische Mittelwert, der durch einzelne Spitzengehälter verzerrt werden kann. Der Medianverdienst der Gesamtbevölkerung liegt jedoch bei etwa 3100 Euro. Positiv kann man erwähnen, dass diese Flüchtlinge überhaupt einer Beschäftigung nachgehen, wobei bereits anhand dieser Zahlen klar wird, dass das Versprechen, es würden hauptsächlich Fachkräfte ins Land kommen, die die deutsche Wirtschaft so dringend braucht, nicht eingehalten wird.
Denn zur Wahrheit gehört, dass viele eben gar nicht arbeiten oder zumindest teilweise vom Staat abhängig sind. Laut IAB beziehen 16 Prozent der 2015 nach Deutschland gekommenen Flüchtlinge auch im Jahr 2024 noch Bürgergeld oder ergänzende Leistungen. In der Gesamtbevölkerung liegt der Anteil der Bürgergeld-Empfänger bei etwa 6,5 Prozent. Der Anteil bei Flüchtlingen ist also rund 2,5 Mal so hoch. Die Tatsache, dass die Abhängigkeit von staatlichen Transferleistungen signifikant höher ist als im Bevölkerungsdurchschnitt, geht in der positiven Erzählung aufgrund der fehlenden Relativierung unter. Hier zeigt sich besonders deutlich, wie durch Framing aus einem ernüchternden Befund eine Erfolgsgeschichte konstruiert wird.
Das Framing ist politisch gewollt
Es bleibt der Eindruck, dass hier ein positives Erzählmuster aufgebaut wird, welches keiner objektiven Bestandsaufnahme standhält. Die freiwillige IAB-Panelstudie, anfällig für Selektionsbias, liefert mit ihrer 64-Prozent-Beschäftigungsquote für 2015er-Geflüchtete ein geschöntes Bild, während der verpflichtende Mikrozensus mit 70 Prozent für die Gesamtbevölkerung robustere Daten bietet. Pikant wird es, wenn der IAB-Migrationsmonitor nur 46 Prozent Beschäftigungsquote für Menschen aus Asylstaaten ausweist – ein Widerspruch, den weder IAB noch Tagesschau ansprechen. Das Framing der Tagesschau, das eine Erfolgsgeschichte feiert, ignoriert die methodischen Schwächen und die ernüchternden Realitäten, wie die 35-Prozent-Quote von Frauen oder die 2,5-fache Bürgergeld-Abhängigkeit.
Abhängigkeit der Institute
Hinzu kommt die eindeutig politische Abhängigkeit der federführenden Institution. Das IAB ist dem Geschäftsbereich der Bundesagentur für Arbeit zugeordnet, diese unterliegt wiederum dem Bundesarbeitsministerium. An dessen Spitze steht mit Andrea Nahles eine ehemalige SPD-Parteivorsitzende und pikanterweise ehemalige Arbeitsministerin. Die politische Prägung ist damit unübersehbar. Solche Verlautbarungen erreichen aufgrund der Reichweite der steuerfinanzierten öffentlich-rechtlichen Medien ein Millionenpublikum. Durch die starke Vereinfachung machen sie sich dadurch – wie leider viel zu viele Politiker und Journalisten – das Motto zu eigen: „Lügen durch Weglassen.“







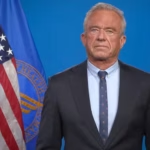



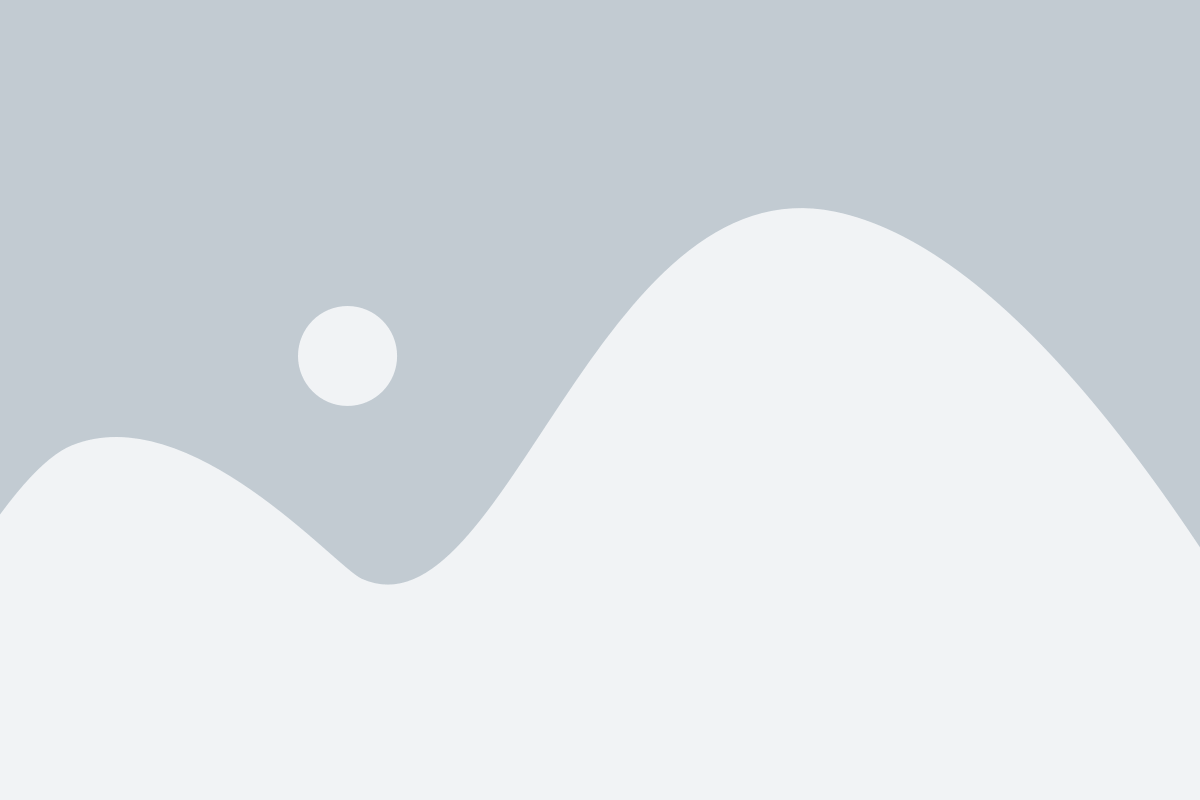







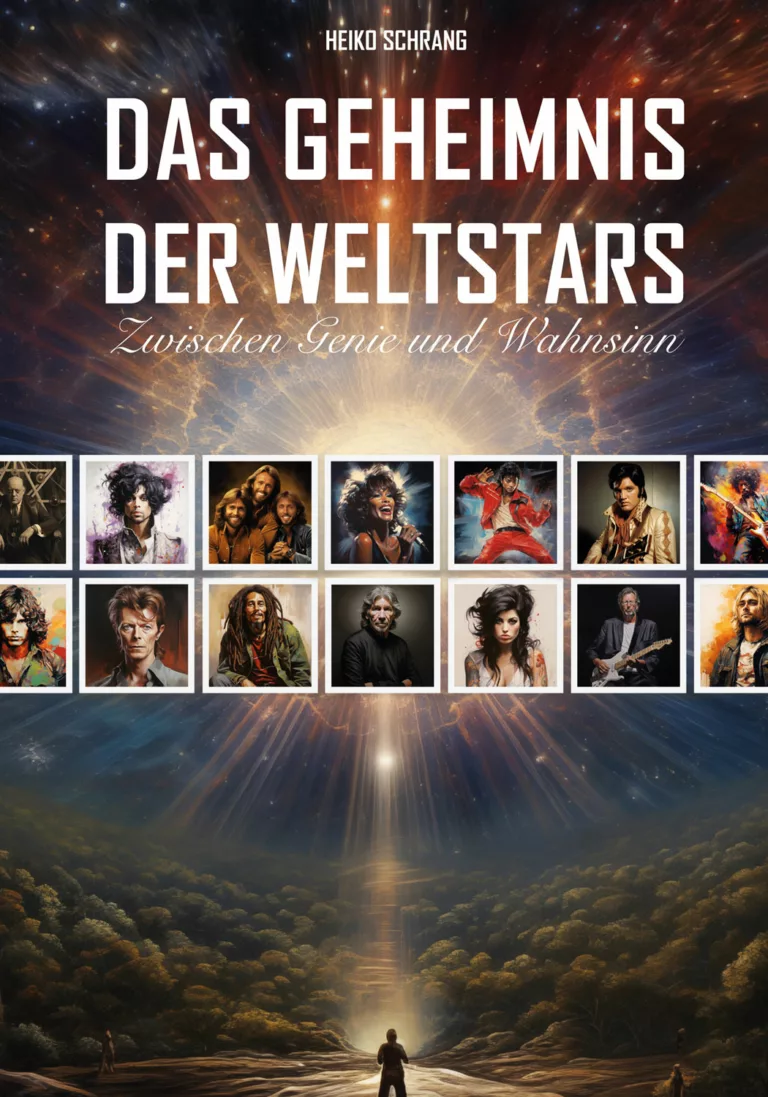




Eine Antwort
Herr Plutz,
es gibt zwei Vermutungen V1 und V2 in
https://haintz.media/artikel/recht/antwort-auf-presseanfrage-zur-untersuchungshaft-des-pianisten-arne-schmidt/#comment-2331
Können Sie uns bitte erhellen?