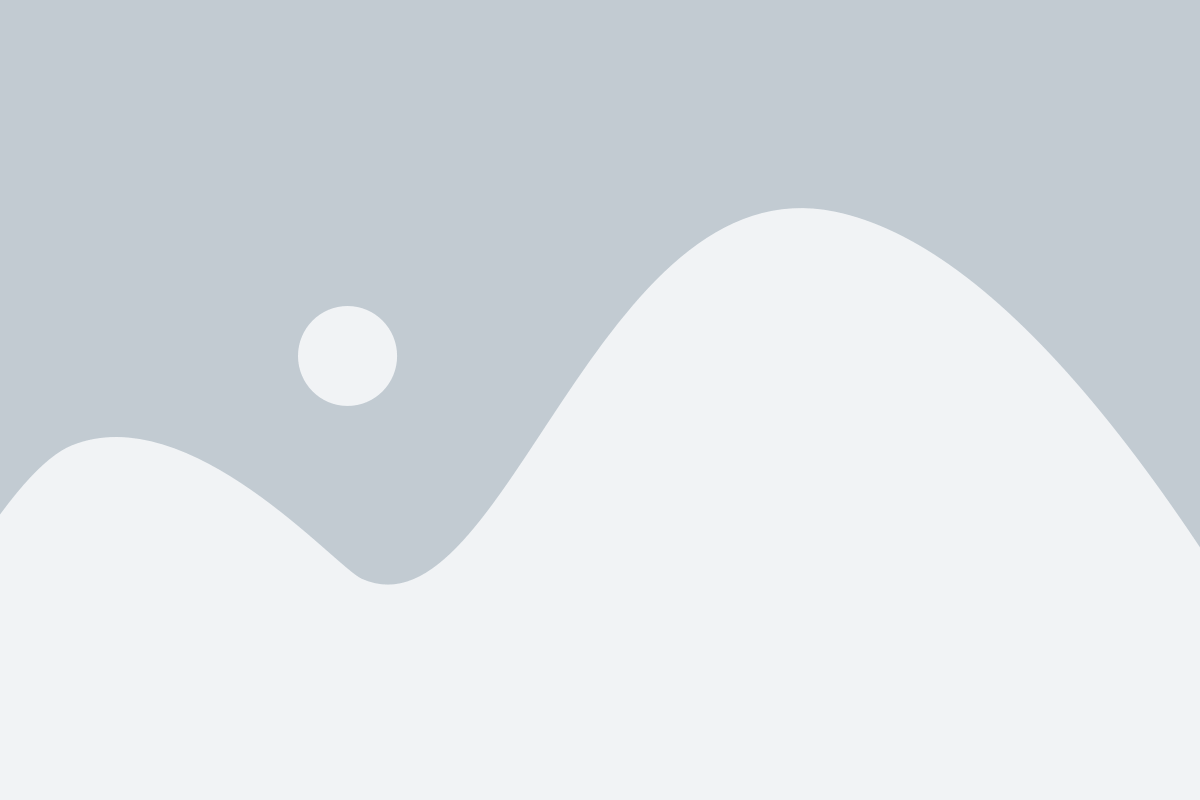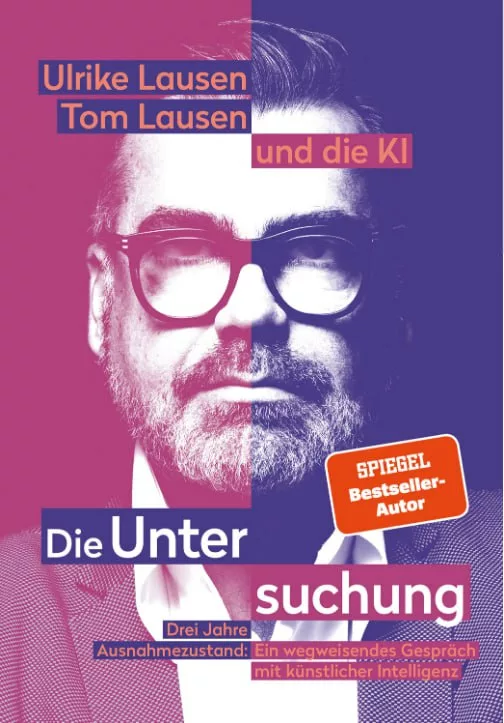In einer Welt, in der „rechts“ zum Schimpfwort verkommen ist, während „links“ als moralischer Freifahrtschein gilt, muss man sich fragen, wie es so weit kam. Deutschland, das Land der historischen Selbstkasteiung, hat „rechts“ zum Synonym für alles Böse gemacht, während „links“ mit Gleichheit, Vielfalt, Fortschritt und Demokratie gleichgesetzt wird. In Wahrheit ein Märchen, das sich die Mainstreammedien gerne erzählen. Denn die Realität ist bissiger: Die politische Linke hat sich in ihrer Selbstgerechtigkeit verfangen, während die Rechte, trotz aller Dämonisierung, oft die klareren Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit liefert. Der Würzburger Historiker Peter Hoeres liefert dafür, »in einer Vortragsreihe«, die Belege: Rechts ist nicht nur eine Richtung, sondern eine anthropologische Konstante, die mit dem Schönen, Wahren und Guten verknüpft ist – von der Antike bis heute.
„Die Unterscheidung zwischen rechts und links ist eine anthropologische Konstante, die historisch durchgängig und global verbreitet ist. Dabei ist rechts überwiegend positiv, links hingegen negativ besetzt. Dies spiegelt sich auch bei uns bis heute sprachlich, religiös und kulturell wider.“
»Peter Hoeres«
Rechts ist nicht gleich rechtsextrem: Die perfide Verdrehung
»Die Französische Revolution« hatte die politische Bühne umgekrempelt: Die Konservativen saßen bei Tagungen der Nationalversammlung rechts, die Reformer links, und seither klebte an „rechts“ zusehends Makel, den die Linke genüsslich ausnutzt. Doch während die SPD sich ungeniert als „linke Mitte“ feiert, windet sich die CDU, um ja nicht als „rechts“ bezeichnet zu werden. Nur vereinzelte Mutige wagen es noch, von der „rechten Mitte“ zu sprechen. Warum diese Scham? Die deutsche Geschichte, insbesondere der Nationalsozialismus, hat „rechts“ stigmatisiert, obwohl selbst Historiker wie Joachim Fest und »Sebastian Haffner« sozialistische Elemente in Hitlers Ideologie erkannten.
„Manche guten Gründe sprechen dafür, dass der Nationalsozialismus politisch eher auf die linke als auf die rechte Seite gehört. Jedenfalls hatte er Zeit seines Bestehens mit dem Totalitarismus Stalins mehr gemein als mit dem Faschismus Mussolinis.“
»Joachim Fest | taz«
Die Gleichsetzung von „rechts“ mit „rechtsextrem“ ist in ihrer Irreführerei kaum zu überbieten. Die heutige „Kampf gegen Rechts“-Rhetorik, exemplarisch aufgebauscht durch »Gerhard Schröders „Aufstand der Anständigen“« nach einem Anschlag auf eine Düsseldorfer Synagoge im Jahr 2000, dient vor allem als instrumentelles Mittel, um alles zu diskreditieren, das nicht ins linke Weltbild passt. Bemerkenswert ist dabei, dass die Täter damals weder der rechten noch der konservativen Szene zuzuordnen waren. Ihr Handeln wurzelte in einer bösartigen, menschenverachtenden, ideologisch diffusen, antisemitischen Motivation, die weder mit traditionellen Werten noch mit den politischen Programmen der heutigen Rechten vergleichbar ist. Dieser Sachverhalt entlarvt die pauschale Verteufelung von „rechts“ als intellektuelle und politische Farce. „Rechts“ ist keineswegs gleichbedeutend mit „rechtsextrem“, sondern stellt einen legitimen und eigenständigen Raum politischer Orientierung dar, den die linke Schwarz-Weiß-Malerei systematisch erstickt.
Der linke Bankrott: Wenn Rechte die besseren Linken sind
Die Ironie der Geschichte ist, dass die Rechte heute oft die Themen aufgreift, die die Linke inzwischen für ideologische Phantasien jenseits der Realität fallenließ. Globalisierungskritik, Konsumskepsis, Verzichtsethik, alles, was früher linke Kernthemen waren, wird nun von Rechten wie Donald Trump lautstark vertreten.
„In manchen Punkten sind die Rechten einfach rechts, in anderen klingen sie wie die besseren Linken: Globalisierungskritik, Konsum- und Kapitalismuskritik, Wachstumskritik, Verzichtsethik – vieles von dem, was sich Linke bloß zu flüstern trauten, sprechen die Rechten offen aus.“
»DIE ZEIT | Sind Rechte die besseren Linken?«
Trump, der die Weltwirtschaft mit Zöllen aus den Angeln heben will, spricht von einer Nation, von Reindustrialisierung und guten Jobs daheim. Donald Trump hatte mehrfach betont, dass der Konsum billiger chinesischer Produkte die US-amerikanische Industrie untergräbt. Er kritisierte, dass diese Produkte nicht nur die heimische Industrie schwächen, sondern auch die amerikanische Gesellschaft negativ beeinflussen.
„Sie suchen immer nach einem Vorteil. Sie haben unser Land jahrelang ausgeraubt. […] China – Junge, die haben unserem Land ganz schön zugesetzt. Sie haben Geld herausgezogen. Jetzt hat sich das umgekehrt.“
»Donald Trump | FOX NEWS | 𝕏«
Was sagt die Linke dazu? Sie verteidigt die bestehenden Finanzmärkte, die Weltordnung, den Status quo, genau das, was sie früher kritisiert hat. In Deutschland empörten sich »Robert Habeck« und »Olaf Scholz« über Trumps Zölle, als wären sie ein Angriff auf die Menschheit, während sie ignorieren, dass Deutschland 2024 Autos im Wert von 44,7 Milliarden Euro in die USA exportierte. Plötzlich sind Linke die Hüter des globalen Kapitalismus, ein Verrat an ihren eigenen Wurzeln.
Die anthropologische Überlegenheit des „Rechts“
Die Präferenz für „rechts“ ist kein Zufall. »Rund 90 Prozent der Menschen sind Rechtshänder«, und im Sprachgebrauch spiegelt sich diese Orientierung wider: „Rechtschaffenheit“ steht für Ehrlichkeit, Ordnung und Verlässlichkeit, während „linkisch“ Unbeholfenheit signalisiert und „hinterlinks“ häufig mit Betrug oder Heimtücke assoziiert wird. »In der Theologie« sitzt der Menschensohn an der rechten Seite Gottes, im Buddhismus führt »die linke Abzweigung nicht ins Nirvana«. Auch in der Ethnologie gilt „rechts“, also das „Recht“, bei den meisten Völkern als positiv besetzt, ein Symbol für Stabilität, Hierarchie und geordnete Strukturen.
Die politische Linke hingegen hat es verstanden, diese universellen Symboliken zu drehen: Sie stellt Gleichheit über alles, während sie Freiheit zugunsten eines abstrakten Ideals opfert, ein Paradox, das Max Horkheimer pointiert auf den Punkt brachte:
„Je mehr Freiheit, desto weniger Gleichheit, je mehr Gleichheit, desto weniger Freiheit.“
Max Horkheimer
Die Rechte dagegen setzt auf individuelle Freiheit, Verantwortungsbewusstsein und einen starken Staat in Sicherheitsfragen, ohne sich für ihre Überzeugungen zu entschuldigen. In diesem Sinne steht „rechts“ nicht nur für Ordnung, sondern für eine Wertorientierung, die Verantwortung, Beständigkeit und klare Prinzipien schätzt, während „links“ oft mit Experimentierfreude, Flexibilität, aber auch Unsicherheit und instabilen Konstruktionen verbunden ist.
Die Mitte als Feigheit: Warum die Volksparteien scheitern
Die großen Volksparteien, CDU und SPD, haben sich nach Links verschoben, wollen aber Mitte sein, nach dem alten Credo von Gerhard Schröder: „Wahlen gewinnt man in der Mitte.“ Doch diese Verschiebung hat sie austauschbar gemacht und die politische Debatte nivelliert. Wenn linke Parteien sich als Mitte inszenieren, verschiebt sich automatisch auch das Spektrum der konservativen Kräfte nach rechts und die einst klar konservative Mittepartei verliert ihre Eigenständigkeit, weil sie sich unbewusst an den linken Definitionen von „Mitte“ orientiert und eigene Kernthemen aufgibt.
Ein anschauliches Beispiel: Die Grünen verfangen sich in ideologischen Träumen um Klimawandel und Lifestyle-Kampagnen, die Linke gleicht ihrer Mutterpartei »und fördert sozialistisches Gedankengut«, während die CDU unter Merz alle konservativen Themen fallenlässt, um den Koalitionspartner SPD zu bedienen. Anpassung an die Mitte macht austauschbar und schwächt jede politische Kraft, während rechte Parteien von klaren Botschaften profitieren. Egal, ob diese ökonomisch oder sozial tragfähig sind. Ähnlich ergeht es der SPD: Statt klare Klassen-Arbeiter-Politik zu betreiben, inszeniert sie sich als verantwortungsvolle Koalitionspartei und verliert ihre Wählerschaft an die Rechte, die das Problem klar adressiert.
Dieses Verschieben der Mitte hat Folgen: Politische Themen werden verzerrt, Debatten verrücken, es entzieht den Parteien jede Eigenständigkeit. Die demokratischen Grundsätze werden nivelliert, ehemals klare Positionen verwässert, und politische Kräfte wirken hilflos im Schatten ihrer selbst. Wer seine Überzeugungen für ideologische Narrative opfert, verliert nicht nur Glaubwürdigkeit, sondern auch die Fähigkeit, überhaupt noch den Diskurs zu bestimmen.
Die Zukunft gehört der Rechten
Die Rechte ist keineswegs frei von Widersprüchen. Sie predigt Verzicht, meint aber meist nur den der Armen. Sie attackiert den Kapitalismus, bleibt selbst aber klassisch rechts in Aktion und Haltung. Ihre Stärke liegt darin, auszusprechen, wovor die Linke längst zurückschreckt. Während linke Kreise moralische Überlegenheit zelebrieren, wirkt die Rechte roh, polemisch, unbequem und genau darin liegt ihre Durchschlagskraft. Parteien wie das BSW entziehen sich klaren Schubladen, indem sie rechte und linke Themen vermischen, ein deutliches Zeichen, dass das alte Links-Rechts-Schema brüchig wird. Die Rechte mag nicht die bessere Linke sein, aber sie ist mutiger. In einer Welt, in der Ängste vor Inflation, Migration und Wohlstandsverlust dominieren, zählt Mut mehr als Gleichheitsfloskeln.
Die Dämonisierung von „rechts“ ist vor allem ein deutsches Spezialproblem, das die Debatte vergiftet. Es wird Zeit, die Ächtung des Begriffs zu beenden. Nur so kann eine ehrliche Auseinandersetzung stattfinden, bei der „links“ und „rechts“ als gleichwertige Pole anerkannt werden. Die Rechte hat die Zeichen der Zeit erkannt: Sie spricht die Sprache der Arbeiter, der Skeptiker, der größten Verlierer der Globalisierung und sie schämt sich nicht dafür. Die Linke verheddert sich in der Verteidigung eines Systems, das sie selbst längst nicht mehr versteht, aber zu ihrem eigenen Vorteil geschaffen hat, während dabei ihre eigenen Werte auf der Strecke bleiben. Es ist Zeit, die Semantik zu entgiften und „rechts“ als das zu sehen, was es ist: Nicht besser, nicht schlechter, sondern vor allem notwendig.